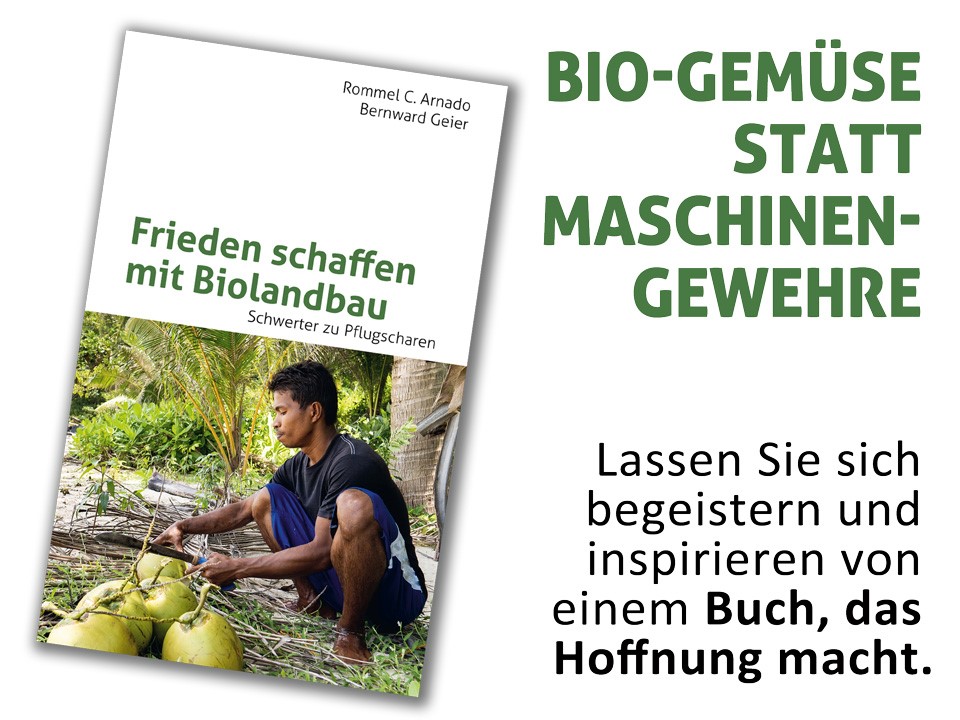Innovation trifft nachhaltige Landwirtschaft
Empowerment von KleinbäuerInnen im globalen Süden
Wie durch Online-Plattformen, Produzentengenossenschaften und Agrarforstwirtschaft Nahrungssicherheit und Empowerment von KleinbäuerInnen im globalen Süden erreicht werden kann.
 Agrarforstwirtschaft stärkt Kleinbauern: Der 'Waldmacher' Tony Rinaudo wurde vergangenes Jahr mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. © Suzy Sainovski
Agrarforstwirtschaft stärkt Kleinbauern: Der 'Waldmacher' Tony Rinaudo wurde vergangenes Jahr mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. © Suzy SainovskiFast 80 Prozent der Armen leben nach Angaben der FAO in ländlichen Gebieten, viele von ihnen sind Kleinbäuerinnen und Kleinbauern auf weltweit rund 500 Millionen Bauernhöfen. Ihnen müssen die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stehen, ihr Land so zu bewirtschaften, dass Ertrag und Verdienst für die Familien stimmen und das Land nachhaltig fruchtbar bleibt. Genau dafür steht Agrarökologie.
Nachdem der World Future Council vergangenen Herbst auf politischer Ebene die besten agrarökologischen Gesetze mit dem „Polit-Oscar" Future Policy Award prämierte, ging dieser nun zusammen mit dem Start-up TAGS (Technology for Agroecology in the Global South) auf Schatzsuche: Mit der Auszeichnung „Outstanding Practices in Agroecology 2019" wurden am 18. Januar die besten Praxisbeispiele geehrt, die Kleinbetriebe stärken sowie nachhaltige Ernährungssysteme und widerstandsfähige landwirtschaftliche Praktiken fördern. Die fünfzehn ausgezeichneten Praxisbeispiele aus Afrika, Asien und Südamerika tragen dazu bei, die Bodenqualität schrittweise zu verbessern und die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel zu erhöhen. Die ausgezeichneten Praxisbeispiele stammen alle aus dem globalen Süden und leisten vor allem eines: Sie schaffen Innovation in der Landwirtschaft dort, wo sie gebraucht wird und sind somit spezifisch an die Bedürfnisse von Mensch, Natur und Wirtschaft vor Ort angepasst.
 Produzentengenossenschaften in Indien konnten den Kleinbauern ihre Unabhängigkeit von Saatgut-Produzenten wiedergeben. © Alliadev, Igapura, 2017
Produzentengenossenschaften in Indien konnten den Kleinbauern ihre Unabhängigkeit von Saatgut-Produzenten wiedergeben. © Alliadev, Igapura, 2017Ein spannender Ansatz, Bioprodukte direkt vom Erzeuger an Verbraucher zu vertreiben, stammt aus Benin. Hier hat sich das Greentech-Unternehmen „Premium Hortus" auf E-Commerce von lokalen agrarökologisch und biologisch produzierten Lebensmitteln spezialisiert. Auf der Online-Plattform können Kunden per Abo günstige Biolebensmittel erwerben. Auf der Erzeuger-Seite bietet „Premium Hortus" Fortbildungen für seine Produzenten an, wodurch die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern nicht nur Ernteverluste um die Hälfte reduzieren konnten, sondern im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft 47 Prozent weniger CO2-Emissionen produzieren. Das Start-up aus Benin expandiert gerade nach Marokko, Togo und Kamerun.
Eine andere Herangehensweise verfolgt das älteste ausgezeichnete Praxisbeispiel, welches aus Ägypten stammt. Die SEKEM-Initiative und ihr Gründer Ibrahim Abouleish (1937-2017) wurden bereits 2003 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet für ein „Geschäftsmodell des 21. Jahrhunderts, das kommerziellen Erfolg mit sozialer und kultureller Entwicklung verbindet", so die Begründung der Jury. 1977 wurde die SEKEM-Initiative mit der Vision von nachhaltiger Entwicklung durch einen ganzheitlichen Ansatz ins Leben gerufen: Ökologie, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sollen dabei gleichrangig betrachtet und behandelt werden. Heute ist SEKEM eines der führenden sozialen Unternehmen, das rund 684 Hektar Land nach 100 Prozent biologisch-dynamischen Methoden bewirtschaftet und all seine Zweifler eines besseren belehrt hat: Die Wüste wurde mithilfe einer konsequenten Nutzung von Kompost begrünt und fruchtbar gemacht. Und es zeigt, dass es anders geht: Insbesondere beim Anbau von Baumwolle wird oft die aggressive Schädlingsbekämpfung mit dem Wunsch nach hohen oder steigenden Erträgen begründet. Heute überholt SEKEM die Konkurrenz bei der Baumwollproduktion um ein Drittel, während auf Pestizide vollständig verzichtet wird.
 High Tech und Nachhaltigkeit gehören zusammen, wie das Green-Tech-Unternehmen 'Premium Hortus' aus Benin zeigt. © Alliadev, Igapura, 2017
High Tech und Nachhaltigkeit gehören zusammen, wie das Green-Tech-Unternehmen 'Premium Hortus' aus Benin zeigt. © Alliadev, Igapura, 2017Wie vielerorts wurde im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh vor vier Jahrzehnten, anstatt auf lokal angepasste und nachhaltige Sorten auf sogenannte „Cash Crops" (Marktkulturen) gesetzt, die Abhängigkeiten zu Saatgutkonzernen schafften. Während die Ausgaben der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ständig stiegen, stagnierten oder fielen ihre Einnahmen. Traurige Folge dieser Entwicklung waren vermehrte Suizide im kleinbäuerlichen Milieu wegen der immer mehr steigenden Schulden. Oft wurde auch das eigene Land aufgegeben und zu einer wenig nachhaltigen Tätigkeit als Tagelöhner gewechselt, was neue Unsicherheiten brachte. Insgesamt wurden patriarchale Strukturen gestärkt, Frauen marginalisiert und die Jugend zunehmend entmutigt, da ihnen die Zukunftsperspektiven fehlten. Das Timbaktu Kollektiv wurde 1991 ins Leben gerufen mit dem Ziel, zunächst den Naturraum mit agrarökologischen Methoden wieder herzustellen. Die Graswurzelorganisation legte besonderen Wert darauf, Frauen und junge Menschen zu stärken. Durch ihre Arbeit konnte sie vielen Menschen, die in der Landwirtschaft tätig waren, agrarökologische Anbauweisen vermitteln und ihnen die Unabhängigkeit über ihr Saatgut wiedergeben. Sie begann mit nur 27 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in einem Dorf, während heute 2.080 Familien in 58 Dörfern von diesem Projekt profitieren - viele von ihnen halten Anteile an der eigenen Produzentengenossenschaft, welche ihnen faire Preise zahlt und ihre Produkte im Süden ganz Indiens vermarktet.
 Durch biologisch-dynamische Anbaumethoden überholte die ägyptische Intiative SEKEM sogar die konventionell anbauende Konkurrenz. © The Timbaktu Collective | SEKEM
Durch biologisch-dynamische Anbaumethoden überholte die ägyptische Intiative SEKEM sogar die konventionell anbauende Konkurrenz. © The Timbaktu Collective | SEKEMJüngst bemerkte Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald, Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung World Future Council und CEO der Schweisfurth Stiftung, die sich für umweltgerechte Landwirtschaft einsetzt: „Um Hunger, soziale Ungleichheit, Klimawandel und den Verlust von Biodiversität erfolgreich anzugehen, ist eine Agrarwende zu nachhaltigen Nahrungs- und Landwirtschaftssystemen dringend nötig. Diese Auszeichnung wirft ein Schlaglicht auf Lösungen, die für die Menschen vor Ort wirklich funktionieren und stärkt diejenigen, die für die Nahrungssicherheit des globalen Südens verantwortlich sind: Kleinbäuerinnen und Kleinbauern."
Kurzum, diese „Outstanding Practices in Agroecology 2019" lohnt es sich wirklich näher zu studieren und ich wünsche mir sehr, dass sich die ausgezeichneten Praxisbeispiele nicht nur im globalen Süden verbreiten – sondern dass auch wir im globalen Norden über den Tellerrand schauen und von den guten Vorbildern in Ägypten, Benin, Indien und anderswo lernen.
Mehr über die Praxisbeispiele finden Sie auf der Website des World Future Councils.
Ingrid Heindorf ist seit 2010 bei der Stiftung World Future Council (WFC) tätig. Sie ist Projektmanagerin Agrarökologie und die Koordinatorin des Genfer Verbindungsbüros.
Quelle: World Future Council. Stimme zukünftiger Generationen
Lifestyle | Essen & Trinken, 01.03.2019
Dieser Artikel ist in forum Nachhaltig Wirtschaften 01/2019 - Time to eat the dog erschienen.

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
14
MAI
2025
MAI
2025
Klimaschutz im peruanischen Regenwald
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
19
MAI
2025
MAI
2025
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Politik
 Hat das Instrument der Demonstrationen ausgedient?
Hat das Instrument der Demonstrationen ausgedient?Christoph Quarch betrachtet die Massendemonstrationen in Georgien, Serbien und der Türkei