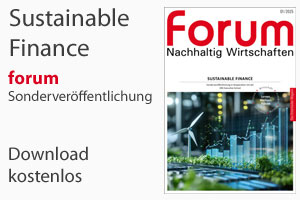Produktion und Verbraucher Hand in Hand
Wir brauchen eine geschlossene Allianz für die Kreislaufwirtschaft
Alle 2,62 Sekunden wird ein Mensch geboren. Jedes Jahr sind wir also rund 80 Millionen Menschen mehr, die mit Wasser und Lebensmitteln versorgt werden müssen. Vor allem die Städte wachsen weiter. In 20 Jahren werden rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Metropolen leben und dort rund 80 Prozent unserer Nahrungsmittel konsumieren - und auch entsorgen. Allein in den Städten wird sich die Abfallmenge bis 2025 voraussichtlich von 1,3 auf 2,6 Milliarden Tonnen pro Jahr verdoppeln. Die Städte stehen also vor der Herausforderung, aus der gegenwärtigen Abfallwirtschaft zukünftig eine Rohstoffindustrie zu machen.
Oriana Romano leitet das OECD-Programm zur Kreislaufwirtschaft in Städten und Regionen. Sie spricht auf dem Global Food Summit im März in München und gab vorab ein Interview. Sie fordert neues, vernetztes Denken von Stadtverwaltungen und keine sektoralen Lösungen, integrative Ansätze des städtischen Umlands oder der traditionellen Landwirtschaftsbetriebe, mit dem Ziel, die städtischen Nahrungsmittelabfällen wiederaufzubereiten.
Frau Romano, die OECD setzt sich für die Einführung einer Kreislaufwirtschaft ein, auch im Lebensmittelbereich. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft?
 Oriana Romano leitet das OECD-Programm zur Kreislaufwirtschaft in Städten und Regionen. © privat
Oriana Romano leitet das OECD-Programm zur Kreislaufwirtschaft in Städten und Regionen. © privatDer Nahrungsmittelsektor wird in mehreren Strategien der Kreislaufwirtschaft berücksichtigt (z.B. in Dänemark, Slowenien, Spanien und den Niederlanden) und ist ein Schlüsselsektor für 52% der Städte und Regionen, die auf die OECD-Umfrage zur Kreislaufwirtschaft in Städten und Regionen geantwortet haben. Es gibt mehrere Beispiele für Initiativen, die den Lebensmittelsektor in städtischen und ländlichen Gebieten zirkulärer gestalten. Diese Initiativen reichen von der Verringerung der Lebensmittelabfälle (Groningen, Umeå, Ljubiana, Porto), der Förderung der städtischen Landwirtschaft (Paris, Brüssel, Guelph), der Unterstützung der lokalen Lebensmittelproduktion (Umeå), der Verbesserung der Koordination zwischen städtischen und ländlichen Gebieten (Valladolid), der Einbeziehung von Restaurants und des Gastgewerbes in diese Bemühungen (Amsterdam, Valladolid, Umeå) oder der Herstellung organischer Düngemittel (Porto, Portugal). Zirkuläre Lebensmittelsysteme in Städten und Regionen basieren auf der Stärkung von Synergien über die gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette von der Produktion bis zum Vertrieb und der Abfallbehandlung.
Wie arbeitet die OECD mit anderen Institutionen zusammen, um das Ernährungssystem der Stadt in eine Kreislaufwirtschaft umzuwandeln? Wie können Regierungen und Behörden für diese Ziele gewonnen werden?
Die OECD hat drei Schlüsselrollen für Städte und Regionen identifiziert, um den Weg zu einer Kreislaufwirtschaft auch im Lebensmittelsektor zu beschreiten. Als solche können Städte und Regionen Förderer, Vermittler und Befähiger sein: Städte und Regionen sind Förderer von Strategien der Kreislaufwirtschaft, indem sie Prioritäten definieren, eine Reihe konkreter Projekte fördern und Interessenvertreter einbeziehen. Städte und Regionen sind Vermittler, wenn sie helfen, Kontakte zu knüpfen und zu erleichtern, über bestehende Projekte zu informieren und eine weiche und harte Infrastruktur für neue Unternehmen der Kreislaufwirtschaft bereitzustellen.
Städte und Regionen sind Befähiger, indem sie die Voraussetzungen für die Entstehung der Kreislaufwirtschaft schaffen. Sie schaffen Anreize, Infrastruktur und katalysieren Fonds. Sie fördern Kommunikation und Bildung. Es ist wichtig, sich von einer Sichtweise zu entfernen, die die Kreislaufwirtschaft als Optimierung des gegenwärtigen linearen Systems begreift: Es geht nicht nur darum, grüne und saubere Techniken für die Produktion oder das Recycling von Abfällen einzusetzen. Es geht darum, die Beziehungen zwischen den Wertschöpfungsketten zu verändern und sektorübergreifende Synergien zu identifizieren. Im Falle von Lebensmitteln können beispielsweise organische Industrieabfälle zur Ökologisierung umweltbelastender Industriengenutzt werden; das Sammeln von Lebensmitteln bei Einzelhändlern und Supermärkten kann die Lebensmittelabfälle reduzieren, während gleichzeitig soziale, wirtschaftliche und ökologische Vorteile erzielt werden können.
Werden Sie die Öffentlichkeit in die Erreichung der Ziele einbeziehen? Wie können die Menschen eine Rolle spielen?
Die Kreislaufwirtschaft ist eine geteilte Verantwortung auf allen Ebenen der Regierungen und der Interessengruppen. Die Koordination über nationale und subnationale Strategienhinweg kann dazu beitragen, Konzepte und Definitionen zu klären und Ziele festzulegen. Die Zusammenarbeit zwischen lokalen, regionalen und nationalen Regierungen ist beispielsweise wichtig, um die für den zirkulären Übergang erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. An der zirkulären Wirtschaft ist ein breites Spektrum von Akteuren beteiligt.
Der Unternehmenssektor ist ein wichtiger Akteur: Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft hängt von seiner Fähigkeit ab, sich auf nachhaltigere Geschäftsmodelle umzustellen (z.B. Verwendung von Sekundärmaterial, Recycling, gemeinsame Nutzung usw.). Die Bürgerinnen und Bürger hingegen können die Produktion durch ihre Entscheidungen als Verbraucher beeinflussen. Die Einbeziehung aller Interessengruppen erfordert aktive, spezifische und maßgeschneiderte Kommunikationsstrategien. Information ist nicht genug. Die Sensibilisierung für die Kosten, Vorteile, Herausforderungen und Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft ist ebenso wichtig.
Die Stakeholder müssen sich an Projekten beteiligen, um ihre Zustimmung, ihr Vertrauen und ihre Akzeptanz zu sichern. Die verschiedenen Akteure (Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft) haben unterschiedliche Ziele bei der Entwicklung der Kreislaufwirtschaft. Zu diesem Zweck ist es wichtig, die Stakeholder zu gemeinsamen Zielen zu motivieren; Anreize und Rahmenbedingungen zu schaffen für den Ausbau von ausreichenden Systemen um Synergien zu schaffen und damit künftige Gesellschaftshaftung zu reduzieren.
Oriana Romano leitet das OECD-Programm zur Kreislaufwirtschaft in Städten und Regionen. Bevor sie 2013 der OECD beitrat, war sie Forschungsassistentin und Universitätsdozentin für Umweltökonomie am "Centre for International Business and Sustainability" (CIBS), der London Metropolitan University und der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität "L'Orientale" in Neapel, Italien.
Umwelt | Ressourcen, 11.02.2020

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
07
MAI
2025
MAI
2025
MakerCamp Genossenschaften 2025
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
08
MAI
2025
MAI
2025
Die intelligente Transformation: ESG + KI = Zukunftssicherung
Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen
Webinar
Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen
Webinar
14
MAI
2025
MAI
2025
Klimaschutz im peruanischen Regenwald
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Politik
 Verlässlichkeit, Wohlwollen, Verletztlichkeit
Verlässlichkeit, Wohlwollen, VerletztlichkeitChristoph Quarchs Prüfsteine für die Vertrauenswürdigkeit von Politikern
Jetzt auf forum:
Dialog und Kooperation – Sie sind gefragt!
Gesundheits- und Sozialwirtschaft muss auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützt werden
„Ökobilanz-Rechner“ der DEUTSCHEN ROCKWOOL
Porsche investiert entschlossen in die Zukunft
ChangeNOW 2025: Ein Wendepunkt für die Wirtschaft der Zukunft