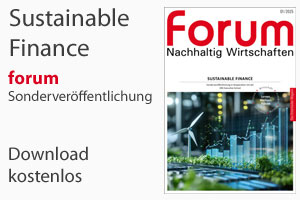Wirtschaft und Demokratie
Wie Unternehmen zum Schutz demokratischer Werte beitragen können
Der zunehmende Rechtsruck in Deutschland bedroht nicht nur die demokratische Gesellschaft, sondern auch den Wirtschaftsstandort. In Zeiten, in denen staatliche Fördermittel für Demokratieprojekte oft unsicher und kurzlebig sind, hat die Privatwirtschaft das Potenzial, eine entscheidende Rolle zu übernehmen. Durch Kooperationen, finanzielle Unterstützung und Engagement in lokalen Netzwerken tragen Unternehmen nicht nur zur Förderung demokratischer Strukturen bei, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zur Stabilität und Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland.
 Besonders im Bereich der Bildung und Wissensvermittlung leisten zivilgesellschaftliche Projekte einen wichtigen kulturellen Beitrag. © Alexandra Ivanciu, 2022
Besonders im Bereich der Bildung und Wissensvermittlung leisten zivilgesellschaftliche Projekte einen wichtigen kulturellen Beitrag. © Alexandra Ivanciu, 2022Seit den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, bei denen die rechtspopulistische AfD starke Zugewinne verzeichnete, ist klar: Rund 30 Prozent der ostdeutschen Wähler*innen unterstützen eine Partei, die die Demokratie radikal einschränken oder sogar abschaffen will. Dieses Ergebnis sollte sowohl der Politik als auch der Wirtschaft zu denken geben. Denn eine derartige politische Verschiebung wirkt sich auf die gesellschaftliche Stabilität und damit auch auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus.
Während die Zivilgesellschaft seit vielen Jahren gegen diese Entwicklungen ankämpft, bleiben politische Maßnahmen zur nachhaltigen Förderung von Demokratieprojekten weitestgehend aus. Staatliche Förderungen sind meist befristet und an wechselnde politische Mehrheiten gebunden. Langfristige und stabile Finanzierungsmodelle für die Demokratiearbeit sind daher notwendig, um Projekte am Leben zu erhalten, die demokratische Strukturen und Werte verteidigen. Hier kann der private Sektor eine entscheidende Rolle spielen.
Diskriminierung und Fachkräftemangel: eine doppelte Herausforderung
Parallel zu den politischen Herausforderungen wächst der Druck auf die Wirtschaft, die Fachkräftelücke zu schließen. Dem Institut der Deutschen Wirtschaft zufolge bleiben derzeit rund 573.000 Stellen unbesetzt. Viele potenziellen Fachkräfte stammen aus Drittstaaten und stehen daher vor zahlreichen Hürden – sei es bei der Anerkennung von Abschlüssen oder aufgrund von diskriminierenden Strukturen auf dem Arbeitsmarkt.
Aus dem aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes geht hervor, dass rund vier von zehn Beratungssuchenden „Diskriminierung aus rassistischen oder antisemitischen Gründen oder wegen der ethnischen Herkunft erlebt haben".
Der überwiegende Teil dieser Fälle ereignet sich am Arbeitsplatz. Gleichzeitig ist das Arbeitsleben jedoch zentral für die gesellschaftliche Teilhabe, da Menschen dort viel Zeit verbringen. Die persönlichen Auswirkungen für Betroffene sind immens. Ausgrenzung, Anfeindungen und Übergriffe werden zum alltäglichen Begleiter und erhöhen das Risiko eines Wegzugs aus der Region. Der Arbeits- und Lebensstandort Deutschland wirkt damit zunehmend unattraktiv.
Um dieser Herausforderung ganzheitlich zu begegnen, bedarf es eines grundlegenden Wandels im öffentlichen Verständnis: Diversität darf nicht länger als rein wirtschaftliche Ressource betrachtet werden. Menschen mit Migrationsgeschichte bringen neue Perspektiven und Ideen ein. Sie tragen somit maßgeblich zur Innovationskraft und Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft bei. Unternehmer*innen, die dies erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, stärken nicht nur den eigenen wirtschaftlichen Erfolg, sondern tragen auch zum Aufbau einer offenen und pluralistischen Gesellschaft bei.
Lokale Netzwerke stärken: die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
Die Herausforderungen, die der Rechtsruck mit sich bringt, können nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft bewältigt werden. Unternehmen sollten sich verstärkt in lokalen Netzwerken engagieren und von der Expertise der Zivilgesellschaft lernen. Viele Initiativen bieten bereits bewährte Ansätze, um demokratische Strukturen zu stärken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Diese Ansätze können durch Kooperationen ausgeweitet und langfristig gefestigt werden.
Ein beeindruckendes Beispiel hierfür ist die Europäische Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz. Die Stadt, die noch 2018 mit rechtsextremen Hetzjagden weltweit für Schlagzeilen sorgte, will im kommenden Jahr ein Zeichen für Offenheit und Vielfalt setzen. Mit Projekten wie „Makers United", einem Festival für Kreativität, Technik und Innovation, und „Makers, Business & Arts", das interdisziplinäre Projekte zwischen Kunst und Wirtschaft fördert, zeigt Chemnitz, wie Unternehmen und Kreativwirtschaft gemeinsam zur Stärkung eines demokratischen Miteinanders beitragen können. Diese Kooperationen fördern nicht nur den interkulturellen Austausch, sondern tragen auch dazu bei, das Selbstverständnis der Menschen vor Ort zu stärken und das Ansehen der Region als weltoffenen Wirtschaftsstandort zu verbessern.
Die Krise der Demokratieprojekte: staatliche Förderung reicht nicht aus
Neben solch positiven Beispielen gibt es jedoch zahlreiche Demokratieprojekte, die sich in einer prekären Lage befinden, wie etwa das geplante Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex in Chemnitz. Dieses Projekt, das die Aufarbeitung der Verbrechen des „Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) und des damit verbundenen Versagens staatlicher Stellen thematisiert, wird im Mai 2025 im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz eröffnet. Ein Meilenstein in der so wichtigen Auseinandersetzung mit Rechtsterrorismus in Deutschland. Doch trotz der großen Bedeutung des Projekts steht die langfristige Finanzierung auf wackeligen Beinen. Der Freistaat Sachsen und der Bund stellen aktuell hohe Fördermittel bereit. Jedoch ist noch unklar, wie die Finanzierung nach dem Jahr 2025 gesichert werden soll.
Diese Unsicherheit ist symptomatisch für viele Demokratieprojekte in Deutschland. Sie hängen oft von politischen Mehrheiten ab, die sich schnell ändern können. Das geforderte Demokratiefördergesetz, welches eine stabile Finanzierungsbasis für Projekte zur Stärkung der Demokratie und zur Bekämpfung von Extremismus bilden soll, scheint in weite Ferne gerückt. Hinzu kommt, dass Vereine aufgrund der Gemeinnützigkeitsregeln keine finanziellen Rücklagen bilden dürfen. Ohne langfristige Finanzierungsmodelle können solche Projekte daher kaum nachhaltig arbeiten und stehen mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 unter enormem Druck – und möglicherweise schon bald vor ihrem Aus.
Privatwirtschaftliche Verantwortung: mehr als nur eine Option
Hier kommt die Privatwirtschaft ins Spiel. Zwar kann sie staatliche Förderstrukturen nicht vollständig ersetzen, doch sie kann entscheidend dazu beitragen, wichtige Demokratieprojekte zu unterstützen. Unternehmer*innen können auf vielfältige Weise einen Beitrag leisten – sei es durch Kooperationen mit Demokratie in Arbeit, Spenden an Beratungseinrichtungen wie das Kulturbüro Sachsen e.V. oder Förderung von sozialen Umverteilungsplattformen wie dem Netzwerk Polylux e.V.. Besonders sinnvoll ist es, wenn Unternehmen dies nutzen, um öffentliche Aufmerksamkeit auf Demokratieprojekte zu lenken und gleichzeitig den Druck auf die Politik zu erhöhen. Denn auch wenn private Mittel eine wichtige Rolle spielen, dürfen sie die staatliche Verantwortung nicht ersetzen.
Die Erfahrungen zu Beginn des Jahres haben gezeigt, dass gemeinsames Handeln große Wirkung entfalten kann. Nach den Enthüllungen des Recherchemagazins Correctiv über die umfassenden Abschiebepläne der AfD kam es zu massenhaften Protesten. Verlage initiierten Medienkampagnen gegen Hass und Hetze, Unternehmen schlossen sich in Wirtschaftsallianzen für mehr Toleranz und Vielfalt zusammen, Gewerkschaften riefen zur Teilnahme an Kundgebungen auf.
Die aktuelle Lage macht jedoch deutlich: Demokratiearbeit braucht vor allem strukturelle Unterstützung, nicht nur aus der Politik, sondern auch von der Wirtschaft. Unternehmer*innen müssen sich bewusst sein, dass nur eine starke Gesellschaft die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg bildet – und dass sie dies nur im Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft erreichen können.
Jule Wittorf ist Programmkoordinatorin des Dokumentationszentrums zum NSU-Komplex in Sachsen bei der Initiative Offene Gesellschaft e.V. in Berlin. Sie forscht zu Rechtsextremismus, Informationspolitik und staatlichen Sicherheitsbehörden.
Gesellschaft | Politik, 16.12.2024
Dieser Artikel ist in forum 01/2025 ist erschienen - Pioniere der Hoffnung erschienen.

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
10
MAI
2025
MAI
2025
Halbtagesexkursion "Energieautarkes Wohnen und Bauen"
In der Reihe "Mein Klima… in München"
82054 Sauerlach
In der Reihe "Mein Klima… in München"
82054 Sauerlach
14
MAI
2025
MAI
2025
Klimaschutz im peruanischen Regenwald
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
19
MAI
2025
MAI
2025
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Digitalisierung
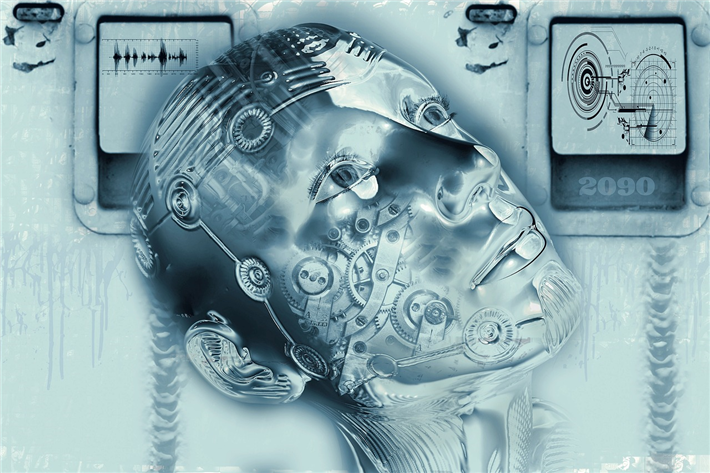 Lässt sich KI politisch einfangen?
Lässt sich KI politisch einfangen?Christoph Quarch ruft zum zeitnahen "Human Action Summit" auf
Jetzt auf forum:
Die Gewinner des The smarter E AWARDS 2025
Erste Sandale aus dem 3D-Drucker
Nachhaltigkeit zwischen Krise und Comeback
Wege gehen im neuen Zeitalter von Unternehmertum
Die Telefonie in Unternehmen im Zeitalter der Vernetzung
HUSUM WIND 2025 startet mit großer Offshore-Exkursion