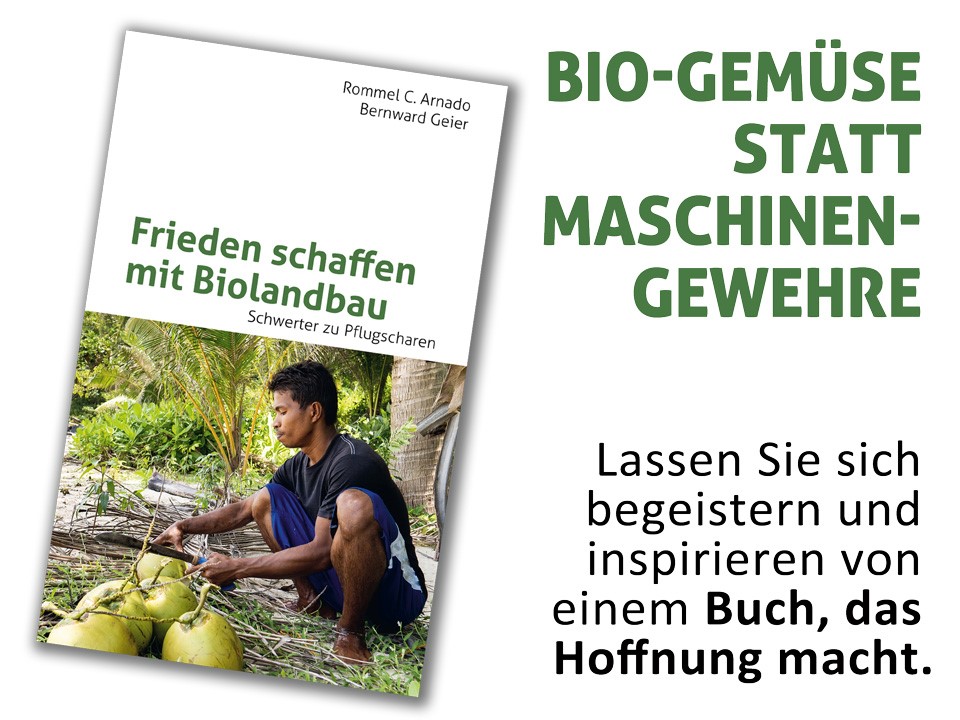Lücken im System
Wenn der Netzausbau die Energiewende bremst
Deutschland will klimaneutral werden. Der Umbau des Energiesystems gilt dafür als zentrale Voraussetzung.
 © seagul, pixabay.com
© seagul, pixabay.comInsbesondere im Norden der Republik wird deutlich, was das bedeutet. Die Windkraftanlagen an den Küsten produzieren regelmäßig mehr Strom, als das bestehende Netz aufnehmen kann. Statt den Überschuss nach Süden zu transportieren, müssen die Windparks häufig heruntergeregelt werden. Allein im Jahr 2022 wurden laut Bundesnetzagentur rund 8,2 Terawattstunden erneuerbarer Strom aus Netzengpassgründen abgeregelt. Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 2,6 Millionen Haushalten.
Der Netzausbau hinkt den Zielen hinterher
Der Transport der Energie von Erzeugungs- zu Verbrauchszentren erfordert ein starkes Übertragungsnetz.
Mit dem Bundesbedarfsplangesetz von 2013 wurden Großprojekte wie SuedLink, SuedOstLink und Ultranet beschlossen – also Gleichstromtrassen, die Windstrom aus dem Norden in den Süden bringen sollen. Die Umsetzung verläuft jedoch schleppend. Laut Netzentwicklungsplan 2037/2045 sind von den rund 12.000 Kilometern an geplanten Netzmaßnahmen bisher nur etwa 2.000 Kilometer realisiert. Die entsprechenden Genehmigungsverfahren, Einsprüche von Anwohnern und die technische Komplexität verzögern den Prozess erheblich.
Gleichzeitig steigen durch den Hochlauf der Elektromobilität, Wärmepumpen und dezentraler Erzeugung die Anforderungen an die Verteilnetze. Die Verteilnetzbetreiber schlagen aufgrund dessen Alarm. In einer Umfrage der Bundesnetzagentur gaben über 80 Prozent von ihnen an, dass der Anschluss neuer PV-Anlagen, Wallboxen oder Wärmepumpen bereits heute eine Herausforderung darstellt – vor allem in ländlichen Regionen.
Übergangslösungen gewinnen an Bedeutung
Der Netzausbau bleibt also hinter den Anforderungen zurück. Vor diesem Hintergrund werden Übergangslösungen zur Stabilisierung des Energiesystems immer relevanter.
Neben dem gezielten Redispatch – also dem Eingreifen in den Kraftwerksbetrieb zur Netzstabilisierung – gewinnen vor allem dezentrale Ansätze an Bedeutung. Dazu zählen etwa Lastmanagement-Strategien, sektorübergreifende Kopplung sowie lokale Speicherlösungen.
Zudem übernehmen Batteriespeichersysteme in diesem Kontext eine immer wichtigere Rolle. Sie ermöglichen es, Strom lokal zwischenzuspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt bedarfsgerecht wieder abzugeben. Das entlastet nicht nur die Netze, sondern reduziert auch die Notwendigkeit, erneuerbare Energie abzuregeln. Erste Stadtwerke und Genossenschaften setzen solche Speicher bereits gezielt ein, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten – etwa in Quartierslösungen, bei denen Photovoltaik, Speicher und Wärmeerzeugung miteinander kombiniert werden.
Flexibilität wird zur neuen Systemleistung
Die klassische Idee, Strom genau dort zu produzieren, wo er gebraucht wird, weicht mittlerweile einem dynamischeren Verständnis. Energie muss künftig vor allem flexibel gehandhabt werden können – sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrageseite.
Dazu braucht es jedoch sowohl innovative Technik als auch regulatorische Anreize. Die Bundesnetzagentur arbeitet derzeit an Modellen, die variable Netzentgelte ermöglichen sollen, um netzdienliches Verhalten zu fördern. Auch das novellierte Energiewirtschaftsgesetz nimmt verstärkt Rücksicht auf Flexibilität und Dezentralität.
Zur gleichen Zeit gewinnen digitale Lösungen an Bedeutung. Intelligente Messsysteme ? die Smart Meter ? sollen es Haushalten und Unternehmen künftig ermöglichen, ihren Verbrauch flexibler an die Netzsituation anzupassen. So könnten Elektrofahrzeuge zum Beispiel in Zeiten niedriger Netzlast geladen werden oder sogar kurzfristig selbst als Speicher fungieren.
Ein Umbau, der mehr Koordination braucht
Die Energiewende erfordert eine neue Architektur des gesamten Systems. Der schleppende Netzausbau zeigt, dass die technischen Lösungen allein nicht ausreichen. Es braucht gut abgestimmte Strategien zwischen Bund, Ländern, Netzbetreibern und Kommunen – und außerdem mehr Tempo in der Umsetzung.
In der Herausforderung liegt jedoch auch eine Chance: Wenn es Deutschland schafft, seine Versorgungssicherheit durch intelligente Netzplanung, flexible Speicher und digitale Steuerung zu garantieren, entsteht ein System, das sowohl nachhaltig als auch resilient ist.
Doch dafür müssen erst einmal die Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht, die Investitionen beschleunigt und Technologien wie Batteriespeichersysteme als Teil eines integrierten Lösungsansatzes verstanden werden – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung.
Technik | Energie, 30.03.2025

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
20
MAI
2025
MAI
2025
24
MAI
2025
MAI
2025
28
MAI
2025
MAI
2025
UPJ-Jahrestagung 2025 - Wirtschaft in Verantwortung!
Preisverleihung des Deutschen Preises für Unternehmensengagement am Vorabend
10785 Berlin
Preisverleihung des Deutschen Preises für Unternehmensengagement am Vorabend
10785 Berlin
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Politik
 Mehr Europa!
Mehr Europa!80 Jahre nach Kriegsende überlegt Christoph Quarch, wie das Bewusstsein für unsere historische Verantwortung an die nächsten Generationen weitergegeben werden kann
Jetzt auf forum:
vPOOL Logistics GmbH auf der transport logistic 2025 in München
Prior1 präsentiert IT Container Eco Fix: Das CO2-optimierte Rechenzentrum aus Holz
EU und AU müssen Weichen stellen für gerechte Partnerschaft für Klima und Entwicklung
Industrie 6.0: Die (R)Evolution beginnt!
MakerCamp Genossenschaften 2025. Die Initiative zur Förderung der Genossenschaftsbewegung