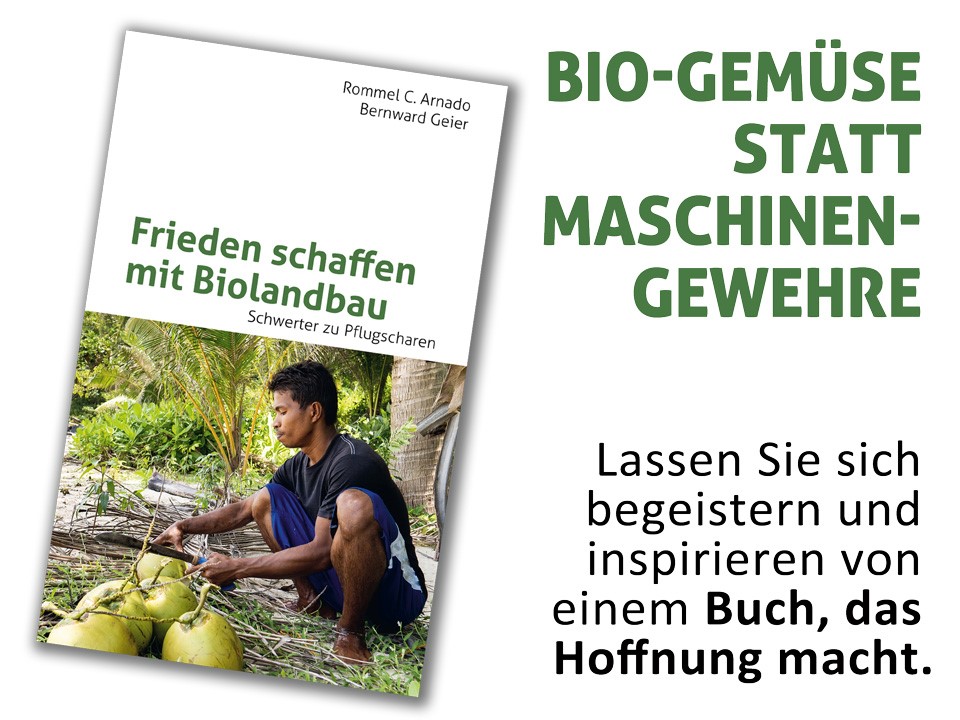By design or by desaster
Was tun Stiftungen, wenn das Wachstum ausbleibt?
Was ist, wenn die Apologeten über das Ende des Wachstums doch Recht behalten? Was passiert dann mit den Stiftungen, die ja darauf ausgelegt sind, gute Zinsen auf ihr Kapital zu erwirtschaften, um aus diesen Erträgen gemeinnützige Projekte zu finanzieren? Ohne Wirtschaftswachstum müssten die Stiftungen ihr Kapital anknabbern, und also wäre auch ihr Ende absehbar.
Mit diesem und weiteren grundlegenden Aspekten der "Herausforderung Wohlstandsverlust" beschäftigten sich Stiftungsvertreter im Arbeitskreis Wissenschaft & Forschung des Bundesverbands Deutscher Stiftungen im November 2010. Dazu eingeladene Experten vertraten unterschiedliche Standpunkte.
Für Professor Meinhard Miegel, Vorstandsvorsitzender der Bonner Stiftung Denkwerk Zukunft, sind die Zeiten des ökonomischen Wachstums bald vorbei, denn es basiere darauf, die natürlichen Ressourcen zu verbrauchen statt zu gebrauchen. Sie aber sind endlich. Die politischen Repräsentanten wüssten das im Grunde, plädierten wie die deutsche Regierung für ein Wirtschaftsmodell, das seine Grundlagen nicht zerstöre, aber zugleich sei "Wachstum, Wachstum, Wachstum" ihr alleiniges Entwicklungsrezept. Diese extreme Widersprüchlichkeit werde darin deutlich, dass Kanzlerin Angela Merkel China für seine hohen Wachstumsraten dankte, von denen auch Deutschland profitiere, während zeitgleich die Vereinten Nationen eben dieses Wachstum als ökologisches Desaster charakterisierten.
In die gleiche Kerbe schlägt die Ehrenvorsitzende der Umweltorganisation BUND und Mitglied im Rat für Nachhaltigkeit der Bundesregierung, Angelika Zahrnt. Sie rät dringend dazu, die natürlichen Grenzen anzuerkennen und jetzt - "nicht erst wenn der Ölpreis stark steigt" - Konzepte für ein Leben in einer Gesellschaft ohne oder mit sehr geringem Wachstum zu entwickeln. Ansätze für eine "Postwachstumsgesellschaft" finden sich im gleichnamigen Buch, das sie zusammen mit der schweizerischen Wissenschaftlerin Irmi Seidel gerade herausgab. Innerhalb einer solchen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung fänden natürlich auch Schrumpfungs- und Wachstumsprozesse, also Strukturwandel statt. "Weil auch das gesamte heutige Sozialsystem von stetigen Wachstumsraten abhängt, muss man über alternative Konzepte wie soziale Selbst- und Nachbarschaftshilfe nachdenken, zum Beispiel Generationenhäuser, Tauschringe etc."
Auch der Kulturwissenschaftler Harald Welzer von der Uni Essen wirbt dafür, endlich in Alternativen zu denken. "Unsere Gesellschaft ist zu 80 Prozent von fossilen Ressourcen abhängig, aber wir haben noch immer keinen Plan B, wenn sie uns in absehbarer Zeit nicht mehr zu Verfügung stehen". Denn nicht alles sei über Erneuerbare Energien zu ersetzen, schließlich gehen nicht nur das Erdöl, sondern auch fast alle anderen wichtigen Rohstoffe zur Neige. Welzer lenkt den Blick auf "Inseln" gesellschaftlicher Innovationen, aus denen größere Trends entstehen könnten: "Warum nicht zum Beispiel Altenheime mit Kindergärten verknüpfen?" Um so gleich mehrere Probleme gleichzeitig anzugehen: die Einsamkeit und Unterforderung der Alten sowie die immer schwierigere Finanzierung von Betreuungseinrichtungen für Kinder.
Einzig Amrit Poser, Chefökonom der schweizerischen Privatbank Sarasin in Basel hielt der geballten Wachstumsskepsis entgegen: Wachstum könne auch dienstleistungsbasiert und damit wenig ressourcenintensiv sein. Er ist relativ entspannt: "Solange es technologischen Fortschritt gibt, gibt es auch Wachstum." Grenzen setzten allein knappe Ressourcen, doch auch hier ist er optimistisch, dass Effizienzstrategien helfen werden.
Stiftungen müssen "deutlich anders denken"
Stiftungen, so Poser, sollten sich deshalb vor allem darauf konzentrieren, den technischen Fortschritt zu fördern und ihr Geld nachhaltig zu investieren, das heißt in Firmen und Projekte, die sozial und ökologisch hohen Ansprüchen folgen.
Meinhard Miegel hingegen forderte die Stiftungen dringend auf, sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen, wenn sie infolge weiter sinkenden oder gar ausbleibenden Zinsen zu "Verbrauchsstiftungen" werden. "Das muss kein Schreckensszenario sein, denn Stiftungen sind nicht auf die Ewigkeit angelegt, sondern sollen ihren Stiftungszweck erfüllen." Damit müssten sie aber "deutlich anders denken". Darüber hinaus sollten sie überlegen, wie sie die Transformation zur Postwachstumsgesellschaft begleiten können: "Wie kann man zum Beispiel immaterielle Wohlstandsquellen erschließen?"
Auch Angelika Zahrnt sieht wichtige neue Aufgaben auf die Stiftungen zukommen: Vor allem sollten sie Experten dabei unterstützen, grundsätzliche Alternativkonzepte für das Gesundheitswesen, die Rentenversicherung und das gesamte Sozialsystem zu entwerfen. Zudem müsse man praktische Beispiele alternativer Lebensmodelle und ihre Erfolgsperspektiven untersuchen, entwickeln und fördern.
Harald Welzer sieht eine Chance darin, dass Stiftungen helfen könnten, das "Gefangensein in mentalen Wachstumskonzepten" aufzulösen, indem sie Projekte auflegen, die zeigen, wie der kulturelle Wandel gelingen kann.
Letztlich, sagt Angelia Zahrnt, stehen wir vor der Frage, "ob wir die unausweichlichen Veränderungen erleben, in dem wie sie gestalten, oder ob sie uns überrollen - by design or desaster."
Von Heike Leitschuh
 Heike Leitschuh (Jg. 1958) ist Autorin, Journalistin und Moderatorin für Nachhaltigkeit. Sie ist Mitherausgeberin des Jahrbuch Ökologie und lebt in Frankfurt (www.fairwirtschaften.de).
Heike Leitschuh (Jg. 1958) ist Autorin, Journalistin und Moderatorin für Nachhaltigkeit. Sie ist Mitherausgeberin des Jahrbuch Ökologie und lebt in Frankfurt (www.fairwirtschaften.de).
Mit diesem und weiteren grundlegenden Aspekten der "Herausforderung Wohlstandsverlust" beschäftigten sich Stiftungsvertreter im Arbeitskreis Wissenschaft & Forschung des Bundesverbands Deutscher Stiftungen im November 2010. Dazu eingeladene Experten vertraten unterschiedliche Standpunkte.
Für Professor Meinhard Miegel, Vorstandsvorsitzender der Bonner Stiftung Denkwerk Zukunft, sind die Zeiten des ökonomischen Wachstums bald vorbei, denn es basiere darauf, die natürlichen Ressourcen zu verbrauchen statt zu gebrauchen. Sie aber sind endlich. Die politischen Repräsentanten wüssten das im Grunde, plädierten wie die deutsche Regierung für ein Wirtschaftsmodell, das seine Grundlagen nicht zerstöre, aber zugleich sei "Wachstum, Wachstum, Wachstum" ihr alleiniges Entwicklungsrezept. Diese extreme Widersprüchlichkeit werde darin deutlich, dass Kanzlerin Angela Merkel China für seine hohen Wachstumsraten dankte, von denen auch Deutschland profitiere, während zeitgleich die Vereinten Nationen eben dieses Wachstum als ökologisches Desaster charakterisierten.
In die gleiche Kerbe schlägt die Ehrenvorsitzende der Umweltorganisation BUND und Mitglied im Rat für Nachhaltigkeit der Bundesregierung, Angelika Zahrnt. Sie rät dringend dazu, die natürlichen Grenzen anzuerkennen und jetzt - "nicht erst wenn der Ölpreis stark steigt" - Konzepte für ein Leben in einer Gesellschaft ohne oder mit sehr geringem Wachstum zu entwickeln. Ansätze für eine "Postwachstumsgesellschaft" finden sich im gleichnamigen Buch, das sie zusammen mit der schweizerischen Wissenschaftlerin Irmi Seidel gerade herausgab. Innerhalb einer solchen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung fänden natürlich auch Schrumpfungs- und Wachstumsprozesse, also Strukturwandel statt. "Weil auch das gesamte heutige Sozialsystem von stetigen Wachstumsraten abhängt, muss man über alternative Konzepte wie soziale Selbst- und Nachbarschaftshilfe nachdenken, zum Beispiel Generationenhäuser, Tauschringe etc."
Auch der Kulturwissenschaftler Harald Welzer von der Uni Essen wirbt dafür, endlich in Alternativen zu denken. "Unsere Gesellschaft ist zu 80 Prozent von fossilen Ressourcen abhängig, aber wir haben noch immer keinen Plan B, wenn sie uns in absehbarer Zeit nicht mehr zu Verfügung stehen". Denn nicht alles sei über Erneuerbare Energien zu ersetzen, schließlich gehen nicht nur das Erdöl, sondern auch fast alle anderen wichtigen Rohstoffe zur Neige. Welzer lenkt den Blick auf "Inseln" gesellschaftlicher Innovationen, aus denen größere Trends entstehen könnten: "Warum nicht zum Beispiel Altenheime mit Kindergärten verknüpfen?" Um so gleich mehrere Probleme gleichzeitig anzugehen: die Einsamkeit und Unterforderung der Alten sowie die immer schwierigere Finanzierung von Betreuungseinrichtungen für Kinder.
Einzig Amrit Poser, Chefökonom der schweizerischen Privatbank Sarasin in Basel hielt der geballten Wachstumsskepsis entgegen: Wachstum könne auch dienstleistungsbasiert und damit wenig ressourcenintensiv sein. Er ist relativ entspannt: "Solange es technologischen Fortschritt gibt, gibt es auch Wachstum." Grenzen setzten allein knappe Ressourcen, doch auch hier ist er optimistisch, dass Effizienzstrategien helfen werden.
Stiftungen müssen "deutlich anders denken"
Stiftungen, so Poser, sollten sich deshalb vor allem darauf konzentrieren, den technischen Fortschritt zu fördern und ihr Geld nachhaltig zu investieren, das heißt in Firmen und Projekte, die sozial und ökologisch hohen Ansprüchen folgen.
Meinhard Miegel hingegen forderte die Stiftungen dringend auf, sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen, wenn sie infolge weiter sinkenden oder gar ausbleibenden Zinsen zu "Verbrauchsstiftungen" werden. "Das muss kein Schreckensszenario sein, denn Stiftungen sind nicht auf die Ewigkeit angelegt, sondern sollen ihren Stiftungszweck erfüllen." Damit müssten sie aber "deutlich anders denken". Darüber hinaus sollten sie überlegen, wie sie die Transformation zur Postwachstumsgesellschaft begleiten können: "Wie kann man zum Beispiel immaterielle Wohlstandsquellen erschließen?"
Auch Angelika Zahrnt sieht wichtige neue Aufgaben auf die Stiftungen zukommen: Vor allem sollten sie Experten dabei unterstützen, grundsätzliche Alternativkonzepte für das Gesundheitswesen, die Rentenversicherung und das gesamte Sozialsystem zu entwerfen. Zudem müsse man praktische Beispiele alternativer Lebensmodelle und ihre Erfolgsperspektiven untersuchen, entwickeln und fördern.
Harald Welzer sieht eine Chance darin, dass Stiftungen helfen könnten, das "Gefangensein in mentalen Wachstumskonzepten" aufzulösen, indem sie Projekte auflegen, die zeigen, wie der kulturelle Wandel gelingen kann.
Letztlich, sagt Angelia Zahrnt, stehen wir vor der Frage, "ob wir die unausweichlichen Veränderungen erleben, in dem wie sie gestalten, oder ob sie uns überrollen - by design or desaster."
 Heike Leitschuh (Jg. 1958) ist Autorin, Journalistin und Moderatorin für Nachhaltigkeit. Sie ist Mitherausgeberin des Jahrbuch Ökologie und lebt in Frankfurt (www.fairwirtschaften.de).
Heike Leitschuh (Jg. 1958) ist Autorin, Journalistin und Moderatorin für Nachhaltigkeit. Sie ist Mitherausgeberin des Jahrbuch Ökologie und lebt in Frankfurt (www.fairwirtschaften.de).Quelle:
Wirtschaft | CSR & Strategie, 06.12.2010

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
30
APR
2025
APR
2025
Franz Alt: Die Solare Weltrevolution - Aufbruch in eine neue Menschheitsepoche
In der Reihe "Mein Klima… in München"
80331 München und online
In der Reihe "Mein Klima… in München"
80331 München und online
07
MAI
2025
MAI
2025
MakerCamp Genossenschaften 2025
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
14
MAI
2025
MAI
2025
Klimaschutz im peruanischen Regenwald
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
29
JUN
2025
JUN
2025
Constellations Week 2025 in Südtirol
Inspiration, Klarheit und Empowerment
I-39010 Tisens-Prissian, Südtirol
Inspiration, Klarheit und Empowerment
I-39010 Tisens-Prissian, Südtirol
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Politik
 Verlässlichkeit, Wohlwollen, Verletztlichkeit
Verlässlichkeit, Wohlwollen, VerletztlichkeitChristoph Quarchs Prüfsteine für die Vertrauenswürdigkeit von Politikern