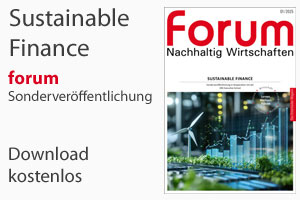Die Mission 2030
Österreichs Weg zur CO2-freien Gesellschaft
Beim UN-Klimagipfel geht es ums Ganze: Wir müssen den Klimawandel bremsen! Laut IPCC-Sonderbericht vom Oktober ist die Erde bereits jetzt um ein Grad wärmer. Nur mit radikalen, schnellen Veränderungen sei die Zielmarke von Paris noch zu erreichen. Schon jetzt zeigen Starkwetterereignisse, dass es Zeit ist, beherzter zu handeln.
 Österreich will in Sachen Klimaschutz die gesetzten Ziele vorbildlich erfüllen. Die Mission 2030 legt dazu den Grundstein. © Karsten Wurth, pexels
Österreich will in Sachen Klimaschutz die gesetzten Ziele vorbildlich erfüllen. Die Mission 2030 legt dazu den Grundstein. © Karsten Wurth, pexelsÖsterreich will hier, nicht zuletzt wegen seiner aktuellen Ratspräsidentschaft, Zeichen setzen – und hat eine ehrgeizige Mission 2030 auf den Weg gebracht. Die nächste Etappe zur Erreichung der EU-Ziele sieht für Österreich bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von minus 36 Prozent gegenüber 2005 vor und da gilt es, noch einiges zu tun, denn zur Halbzeit ist man – ähnlich wie Deutschland und andere EU Staaten – noch nicht auf der Ziellinie und muss noch kräftig zulegen. In Österreich wurden von den geplanten 36 Prozent bisher nur acht Prozent Reduktion erreicht. Die nächsten 28 Prozentpunkte müssen in den kommenden zwölf Jahren erreicht werden. Da die Summe der bisher gesetzten Einzelmaßnahmen nicht zum Ziel führt, wurde von der neuen Bundesregierung Anfang dieses Jahres die Erarbeitung einer Klima- und Energiestrategie beschlossen. Diese erfolgte unter Federführung des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur (BMVIT) und unter Mitwirkung von Topexperten aus den Bereichen Umwelt, Energie, Klimaschutz und Verkehr der beiden Ressorts. Bereits Anfang April konnte die „#mission2030 – die Klima- und Energiestrategie der Österreichischen Bundesregierung" präsentiert werden. Die geplanten Aktionen sind ambitioniert und Österreich hat sich die Latte hoch gelegt.
Ziel ist die CO2-freie Gesellschaft
Bis 2050 strebt Österreich jedenfalls den Ausstieg aus der fossilen Energiewirtschaft und damit die Dekarbonisierung der Gesellschaft an. Die Klima- und Energiestrategie soll die Basis sein, auf der die dafür notwendigen Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Den Rahmen bilden dabei drei grundlegende Ziele: die ökologische Nachhaltigkeit, die nationale Versorgungssicherheit sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Diese vordergründig unterschiedlichen Ziele sollen dabei gleichwertig berücksichtigt und so aufeinander abgestimmt sein, dass sie sich gegenseitig bestmöglich unterstützen.
Ökologische Nachhaltigkeit
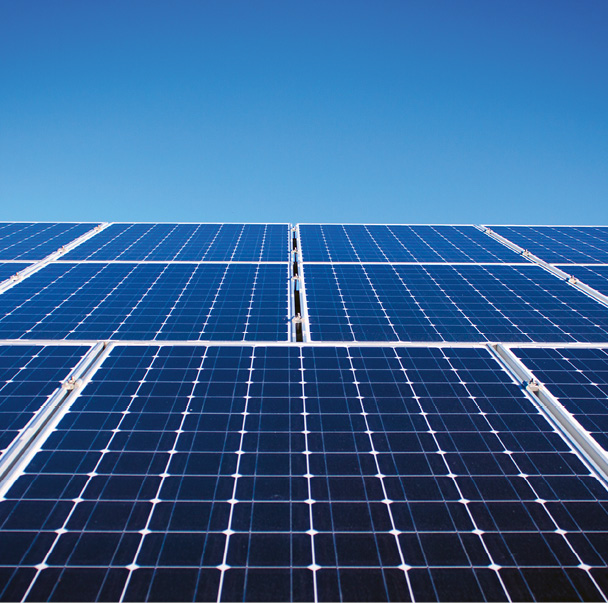 © Carl Attard pexels-photo-solar
© Carl Attard pexels-photo-solarDer Anteil erneuerbarer Energie am Bruttoendenergieverbrauch soll bis 2030 von 33,5 auf 45 bis 50 Prozent angehoben werden. Der Stromverbrauch soll gar zu 100 Prozent (national bilanziell) aus erneuerbaren Energiequellen im Inland gedeckt werden.
Versorgungssicherheit zu tragbaren Preisen
Nachhaltige Versorgungssicherheit bedeutet bei der Transformation des Energiesystems, dass sowohl die kurz- wie auch die langfristige Verfügbarkeit von Energie in ausreichender Menge und zu jedem beliebigen Zeitpunkt gewährleistet ist. Ebenso deren Leistbarkeit, denn auch in Zukunft sollen alle Bevölkerungsgruppen ihren elementaren Energie- und Mobilitätsbedarf zu gesellschaftlich tragbaren Kosten decken können.
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft
Analoges gilt für die Wirtschaft. Für eine erfolgreiche Umsetzung der Klimaziele ist die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft zentral. Preisbildungsmechanismen sollen deshalb Marktverzerrungen unter Berücksichtigung von Steuern, Abgaben und Anreizen so weit wie möglich eindämmen. Sie sollen Haushalte, Gewerbe und Industrie in die Lage versetzen, sich aktiv am Energiemarkt zu beteiligen und auf Preissignale schnell reagieren zu können.
Land der Energieinnovationen
 © Gazprom
© GazpromEnergie und Umwelt als Jobmotor
Wer immer nur über die großen Belastungen einer Energiewende klagt und die Beschlüsse von Paris als nicht finanzierbar beschreibt, übersieht die positiven Effekte. Zum einen ist der Bereich der Umwelttechnikindustrie einer der größten Wachstumsmärkte des 21. Jahrhunderts. Zum anderen sind Energie- und Umwelttechnologien Innovationstreiber. Ihre schnelle Entwicklung ist ein Gewinn für Klima, Standort und Beschäftigung und stärkt den Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort. Schon heute ist die österreichische Energie- und Umwelttechnikindustrie eine robuste Zukunftsbranche mit großem Exportpotenzial. 2015 generierte alleine deren produzierender Bereich einen gesamtwirtschaftlichen Umsatz von rund 18 Milliarden Euro und sichert damit mehr als 90.000 Arbeitsplätze. Dazu kommt, dass jeder neue Beschäftigte in der Umwelttechnikindustrie annähernd zwei zusätzliche Arbeitsplätze in anderen Bereichen der heimischen Volkswirtschaft bewirkt und die Exportquote (Anteil der Exporte an den Gesamtumsätzen) bereits 72 Prozent beträgt. Welches Potenzial die Zukunft verspricht, zeigt alleine der Bereich E-Mobilität. Alleine dort können in Österreich bis 2030 insgesamt fast 34.000 neue Jobs und 3,1 Milliarden Euro Wertschöpfung zusätzlich entstehen.
Der Weg zur CO2-freien Gesellschaft
 Mir überschüssigem Strom aus Windkraft und Photovoltaik wird Wasserstoff und Methan produziert. Die bereits vorhandene Infrastruktur an Leitungen und Lagerstätten für Erdgas ist hervorragend geeignet, dieses Gas nutzbar zu machen und auch zu speichern. Über Blockheizkraftwerke können dann erneut Strom und Wärme produziert werden. © agriexpo
Mir überschüssigem Strom aus Windkraft und Photovoltaik wird Wasserstoff und Methan produziert. Die bereits vorhandene Infrastruktur an Leitungen und Lagerstätten für Erdgas ist hervorragend geeignet, dieses Gas nutzbar zu machen und auch zu speichern. Über Blockheizkraftwerke können dann erneut Strom und Wärme produziert werden. © agriexpoDoch wie in Deutschland läuft die Elektrifizierung von PKW, Transporter und LKW nur schleppend an. Aktuell beträgt in Österreich der Anteil von E-Fahrzeugen bei den PKW-Neuzulassungen gerade einmal 2,25 Prozent und im PKW-Gesamtbestand 0,39 Prozent. Um deren Anteil zu erhöhen, will man deshalb emissionsfreie Fahrzeuge entschieden bevorzugen. Bei Neuzulassungen soll künftig das Prinzip der Vollkosten, auch „Total Cost of Ownership (TCO)", gelten und die öffentliche Hand wird dabei eine Vorbildrolle übernehmen. Im Rahmen der routinemäßigen Ersatzbeschaffungen werden öffentliche Fuhrparks auf Null- und Niedrigstemissionsfahrzeuge umgestellt. Eine entsprechende Vorbildwirkung darf man sich auch vom Umstieg des öffentlichen Nahverkehrs auf E-Mobilität erwarten. Ebenso von neuen Angeboten wie E-Car-Sharing, E-Taxi-Systemen, E-Bike-Verleihsystemen oder E-Zustellservices. Ein interessantes Projekt aus dem Bereich emissionsneutrale Logistik ist „MegaWATT". Das gemeinsame Projekt von Klima- und Energiefonds und Universität für Bodenkultur untersucht die Voraussetzungen für den österreichweiten Einsatz von E-Lkws in Städten bis 2021. Damit könnten die Treibhausgasemissionen um 3.600 Tonnen CO2 reduziert werden.
Ab auf die Schiene
Apropos Verkehr und CO2: Das größte Klimaschutzunternehmen Österreichs sind die ÖBB, die mit ihren Verkehrsleistungen auf der Schiene dem Land schon heute drei Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr ersparen. Die Bahn ist damit 14- mal klimafreundlicher als ein durchschnittlicher PKW und 40-mal klimafreundlicher als das Flugzeug unterwegs. Mit Investitionen in Höhe von knapp 14 Milliarden Euro in den nächsten Jahren soll diese Stärke weiter ausgebaut werden. Ein konkretes Ziel ist beispielsweise, den Elektrifizierungsgrad im Netz der ÖBB von derzeit 73 Prozent auf ca. 79 Prozent zu steigern.
Schwerpunkt Lade-Infrastruktur
Was es braucht, damit die E-Mobilität auf Österreichs Straßen richtig durchstarten kann, ist eine österreichweite Infrastruktur in Form von Ladestationen. Ein spezieller Fokus wird dabei auf E-Tankstellen entlang von Autobahnen gesetzt. Bereits in diesem Jahr wird es dort 23 Elektrotankstellen geben, jede davon ausgestattet mit zumindest vier gleichzeitig zu verwendenden Ladepunkten. Mittelfristiges Ziel ist, dass es alle 100 Autobahnkilometer eine Ladestation gibt. Aber besonders attraktiv und deshalb noch wichtiger ist die E-Mobilität im Kurz- und Mittelstreckenverkehr. Deshalb soll die Errichtung von E-Ladestationen in Mehrparteienhäusern durch entsprechende Förderungen und eine Anpassung des Wohnrechts leichter gemacht werden. Zusätzliche Förderanreize gibt es auch für Städte, Gemeinden oder auch Unternehmen, damit sie die notwendige Infrastruktur noch schneller bereitstellen.
Erneuerbarer Strom aus der Sonne
Sollen die fossilen Energieträger der Vergangenheit angehören, braucht es sauberen Strom als Alternative. Ziel der österreichischen Regierung ist es, dass bis 2030 der heimische Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen kommt – derzeit sind es 72 Prozent. Einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stromerzeugung können künftig Photovoltaikanlagen leisten. Vor allem Dachflächen bieten dafür ein ungenutztes Potenzial. Entsprechend trägt eines der Leuchtturmprojekte der #mission2030 den Titel „100.000 Dächer Photovoltaik und Kleinspeicher-Programm". Im Rahmen dieser Maßnahme soll eine Investitionsförderung Anreize zu einer verstärkten Nutzung der Dachflächen durch Photovoltaikmodule für Privatpersonen und Wirtschaftstreibende schaffen. Derzeit gibt es in Österreich rund 125.000 Photovoltaikanlagen, die zusammen 1.096 Gwh Strom erzeugen und damit 400.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Dennoch entspricht diese Erzeugungsquote lediglich einem Anteil von einem Prozent am heimischen erneuerbaren Endverbrauch. Zusätzlich zu den Investitionsförderungen des „100.000 Dächer Photovoltaik- und Kleinspeicher-Programms" soll eine Steuerbefreiung den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Strom erhöhen. Die Beseitigung von Investitionshindernissen im Wohn- und Anlagenrecht soll ein Übriges tun.
An der Sektorenkoppelung führt kein Weg vorbei
|
Leuchtturm-Projekte Austria
|
Was erneuerbare von fossilen Energieträgern unterscheidet, ist, dass sie nicht immer dann produzieren, wenn Energie benötigt wird. Der Erfolg der Energiewende ist daher auch eine Frage des Zusammenspiels der bislang getrennten Sektoren des Energiesystems wie Strom, Wärme, Mobilität oder Industrie. Um den Schwankungen in der Erzeugung wie beim Bedarf gewachsen zu sein, müssen diese Sektoren miteinander verknüpft werden. Die Sektorenkopplung bzw. Integrated Energy gilt daher als Schlüsseltechnologie. Denn erst die gemeinsame Betrachtung und Vernetzung aller Sektoren schafft die notwendigen Synergieeffekte bei der Integration von hohen Anteilen erneuerbarer Energien. Beispielsweise durch die Nutzung großer und günstiger Energiespeicher außerhalb des Stromsektors oder durch Optimierung der Flexibilität in der Stromnachfrage. Dadurch können die Schwankungen der variablen erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie ausgeglichen werden, ohne zu stark auf teurere Stromspeicher setzen zu müssen. Trotzdem braucht es Lösungen, die die Versorgung auch dann sichern, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Ein natürlicher Energiespeicher ist Biomasse, aus der über Kraft-Wärme-Kopplung bedarfsgerecht sowohl Wärme und Kälte als auch Strom bereitgestellt und nachhaltige Bio-Kraftstoffe hergestellt werden können.
Neue Speicherlösungen sind gefragt
Die Speicherung von überschüssigem Strom wird mit Ausbau der Erneuerbaren immer wichtiger. Anstatt, wie heute üblich, zu Spitzenerzeugungszeiten beispielsweise Windparks abzuschalten, will man Ökostrom aus Wind und Sonne auffangen und mit größtmöglicher Effizienz speicherfähig machen. So wird erneuerbare Energie besser planbar. Derzeit werden verschiedene Kopplungselemente eingesetzt oder getestet: Power-to-Gas, Power-to-Heat und Power-to-Chemicals, bei denen jeweils regenerativ erzeugte Elektrizität eingesetzt wird, um Gas oder Wärme zu produzieren oder chemische Energieträger aufzuladen.
Faszinierende Speicherlösungen ergeben sich durch die Einbeziehung bereits bestehender Wärme- oder Kältenetze und selbst dem Abwassersystem kann Energie zugeführt und entnommen werden. Besonders interessant ist das Power-to-Gas (Strom-zu-Gas) Verfahren, bei dem die Spitzenproduktion von Ökostrom dafür genutzt wird, Wasser mittels Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff zu zerlegen. Der Wasserstoff wird dann zum Beispiel in das Erdgasnetz eingespeist und mischt sich mit dem darin enthaltenen Erdgas, das wie gewohnt eingesetzt werden kann. Die Energie ist damit speicherbar geworden. Aus technischen Gründen ist der Anteil von Wasserstoff im Erdgasnetz auf fünf Prozent begrenzt. Das klingt zunächst wenig, ist jedoch bei einem großen Leitungsnetz und hohen Gaslagerkapazitäten eine gigantische Menge! Wenn dieses Speicherpotenzial ausgeschöpft ist, kann der Wasserstoff über einen weiteren Schritt – die Methanisierung – in regeneratives Erdgas umgewandelt und damit ohne Mengenbegrenzung ins Erdgasnetz eingespeist werden. Das Erdgasnetz kann sich somit zur „Batterie" der Energiewende entwickeln.
Besonders für die energieintensive Industrie ist die direkte Nutzung von „erneuerbarem Wasserstoff" interessant. Durch dezentrale Elektrolyseure sowie eine Langfristspeicherung kann Wasserstoff je nach Bedarf vor Ort produziert und genutzt werden, damit die Netzstabilität unterstützen und fossile Energien ersetzen. In diesem Sinne soll also Erdgas sukzessive durch erneuerbares Gas wie Wasserstoff, aber auch Biogas ersetzt werden. Für die Produktion von Biogas kann die Rohstoffversorgung nicht nur aus der Landwirtschaft, sondern vor allem aus der Abfall-, Kompost- und Abwasserwirtschaft kommen. Ein wesentlicher zusätzlicher Nutzen von Biogas liegt in der potenziellen Vermeidung von Methanemissionen aus der Landwirtschaft (Gülleverwertung) sowie in der Gewinnung von Dünger aus dem Gärrestanfall.
Vorschläge aus der Gesellschaft sind gefragt
Österreich hat große und ehrgeizige Pläne und möchte alles daran setzen, die gesteckten Ziele der EU und des Pariser Abkommens zu erreichen. Die Alpenrepublik setzt bei den notwendigen (Verhaltens-)Änderungen nicht auf Verbote, sondern auf eine aktive Partizipation der Bürger und Unternehmen. Gemeinsam mit allen Stakeholdern sollen (gesetzliche) Klimamaßnahmen entwickelt, diskutiert und verabschiedet werden, die den Weg des Landes in die Zukunft sichern.
Von Fritz Lietsch
 Dieser Beitrag ist mit der freundlichen Unterstützung des Österreichischen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie entstanden. Entgeltliche Einschaltung. Dieser Beitrag ist mit der freundlichen Unterstützung des Österreichischen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie entstanden. Entgeltliche Einschaltung. |
Umwelt | Umweltschutz, 01.12.2018
Dieser Artikel ist in forum Nachhaltig Wirtschaften 04/2018 - Frauen bewegen die Welt erschienen.

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
07
MAI
2025
MAI
2025
MakerCamp Genossenschaften 2025
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
08
MAI
2025
MAI
2025
Die intelligente Transformation: ESG + KI = Zukunftssicherung
Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen
Webinar
Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen
Webinar
14
MAI
2025
MAI
2025
Klimaschutz im peruanischen Regenwald
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Digitalisierung
Christoph Quarch empfiehlt allen seriösen Kräften den Rückzug von X