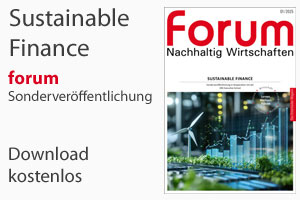Auf Deponien, in Strudeln und Schornsteinen
Langer Weg vom Müll zur Ressource
Der Weg vom Müll zur Ressource ist lang: Weltweit gelangt nur ein Bruchteil der Abfälle zurück in Stoffkreisläufe. In den Ozeanen treiben Millionen Tonnen Plastikteilchen, schrottreife Elektrogeräte landen containerweise und illegal in den Entwicklungsländern. Und hierzulande lässt die Abfallwirtschaft wertvolle Metalle aus Laptops oder Handys „energetisch verwertet" in Rauch aufgehen.
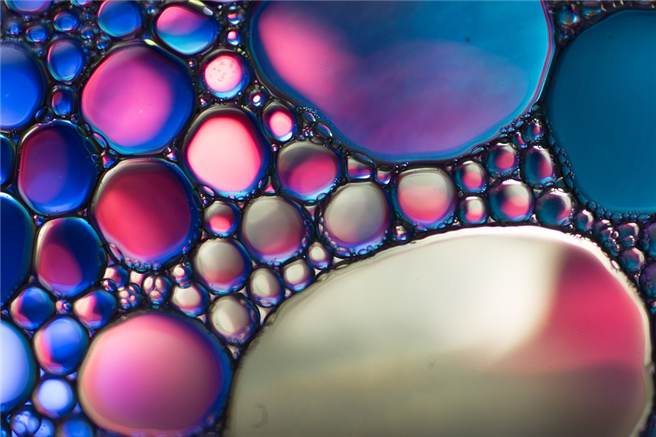 Dreist: 800.000 Liter Abwasser entstehen in einer Woche auf einem Kreuzfahrtschiff, davon sind 13.000 Liter ölhaltiges Wasser – wohin fließt das? © A_Diffrent_Perspective, pixabay.com
Dreist: 800.000 Liter Abwasser entstehen in einer Woche auf einem Kreuzfahrtschiff, davon sind 13.000 Liter ölhaltiges Wasser – wohin fließt das? © A_Diffrent_Perspective, pixabay.comNoch immer bezeichnet sich Deutschland als Recycling-Weltmeister mit hohen Recyclingquoten. Doch mit dem Wording und der Selbstwahrnehmung kann die stoffliche Wirklichkeit nicht mithalten. Das ist ganz nach oben ins öffentliche Bewusstsein geraten, seit beinahe wöchentlich Aufnahmen von Schildkröten mit Strohhalmen in den Nasenlöchern über die Bildschirme flimmern, oder Nachrichten von Walen, die mit einem Bauch voller Kunststoff verhungert sind. Müllkippen für Bauabfälle werden knapp, und für all die neuen Stoffströme, die uns die Energiewende beschert – Windräder aus Verbundmaterialien, oder Lithium-Ionen-Batterien aus Elektroautos –, gibt es bislang noch keine Lösungen. Es ist ja nicht so, dass sich niemand kümmern würde. Klaglos akzeptieren die Bürger eine stetig wachsende Zahl von Mülltonnen vor ihren Häusern, um ihren Abfall sorgfältig zu trennen. Die gesetzliche Regulierung ist enorm: Um Verpackungen aus Plastik oder Pappe hat sich in Deutschland ein ausuferndes Regelwerk gebildet, das genau festlegt, ob Blumentöpfchen nun Teil der Pflanze oder ihre Verpackung sind – all das, um die Finanzierung der Entsorgung zu gewährleisten. Ab Januar nächsten Jahres wird die Verpackungsverordnung deshalb noch mal verschärft. Dann sollen diejenigen Firmen weniger zahlen, deren Verpackungen sich leichter recyceln lassen. Ein Schritt Richtung Öko-Design. Die Branche diskutiert allerdings jetzt schon, wie sich die steigenden Kosten wohl am leichtesten umgehen lassen…
Nix wie weg mit dem Zeug …
Der Kreislauf läuft nicht rund …
 Gegenrechnung: 10 Mrd. Euro Umsatz bezifferten deutsche Recyclingunternehmen 2011. Bis 2015 hat sich der Betrag verdoppeln. Die Rohstoffkosten der deutschen Industrie belaufen sich auf rund 130 Mrd. Euro im Jahr. © fill, pixabay.com
Gegenrechnung: 10 Mrd. Euro Umsatz bezifferten deutsche Recyclingunternehmen 2011. Bis 2015 hat sich der Betrag verdoppeln. Die Rohstoffkosten der deutschen Industrie belaufen sich auf rund 130 Mrd. Euro im Jahr. © fill, pixabay.comEiner weiteren, im Dezember 2011 veröffentlichten UNEP-Studie zufolge fallen in den fünf westafrikanischen Ländern Benin, Elfenbeinküste, Ghana, Liberia und Nigeria pro Jahr rund eine Million Tonnen Elektroschrott an. Etwa ein Viertel davon importieren die Länder bereits als unbrauchbaren Abfall, vor allem aus Europa. Der Rest entstammt dem zunehmenden Konsum vor Ort. Laut Studie gehen in der Region heute zehnmal mehr Computer und hundertmal mehr Handys als noch vor zehn Jahren über die Ladentheke. Die Nachfrage nach gebrauchten Produkten ist hoch – sie sollen aber technisch auf dem neuesten Stand sein. Auch in Nigeria wollen die Kunden Flachbildschirme – und die Röhrenfernseher landen wie hierzulande auf dem Müll. Der Export gebrauchter Geräte in die Region ist also nicht das Problem, sondern der (oftmals illegale) Export schrottreifer Modelle. Sie verschärfen die Entsorgungsproblematik, den der steigende Konsum dort verursacht. Denn eine entsprechende Recyclingindustrie gibt es dort schon gar nicht. Kühlschränke, Fernseher oder Computer werden per Hand ausgeschlachtet. Menschen und Umwelt leiden unter den zum Teil giftigen Inhaltsstoffen. Um an begehrte Materialien wie zum Beispiel Kupfer zu gelangen, brennen die Müllhaldenarbeiter Kunststoffkabel ab – eine Quelle für Luftverschmutzung durch Dioxin. Giftige Inhaltsstoffe wie Quecksilber oder Blei gelangen ins Abwasser, wertvolle und knappe Stoffe gehen verloren. Die Schrottsammlerinnen und -verwerter gehören zu den Ärmsten der Bevölkerung, häufig sind es Kinder. Ihnen ermöglicht die Schrottverwertung auch ohne Ausbildung ein Auskommen – zugleich verhindern sie die Entstehung einer professionellen und zunächst teureren Recyclingindustrie.
 Gruselig: 40 Besuchern der Kino-Premiere von 'Plastic Planet' entnahm man Blutproben und fand darin Spuren von Plastik. © hans, pixabay.com
Gruselig: 40 Besuchern der Kino-Premiere von 'Plastic Planet' entnahm man Blutproben und fand darin Spuren von Plastik. © hans, pixabay.com Zukunftsmusik: 40.000 Tonnen Elektroschrott wie Föhne oder Laptops wandelt das Unternehmen Alba R-Plus in Rohstoffe wie Aluminium, Kupfer und Messing um. Alba meint, in zehn Jahren werde die deutsche Recyclingwirtschaft größer sein als die Autoindustrie. © Didgeman, pixabay.com
Zukunftsmusik: 40.000 Tonnen Elektroschrott wie Föhne oder Laptops wandelt das Unternehmen Alba R-Plus in Rohstoffe wie Aluminium, Kupfer und Messing um. Alba meint, in zehn Jahren werde die deutsche Recyclingwirtschaft größer sein als die Autoindustrie. © Didgeman, pixabay.comPlastik im Magen – Plastik im Blut …
Nicht nur mit Metallen gehen wir um, als ob es kein Morgen gäbe. Plastik ist, neben der Überfischung, zu einer ernsten Bedrohung des Lebens im Meer geworden und hat das Müllthema auch hierzulande wieder aktuell gemacht. Alte Flaschen, Fischernetze, Tüten, Spielzeug – all die bunten Hinterlassenschaften des Erdölzeitalters bilden in den Weltmeeren riesige Strudel. Im größten dieser Müllstrudel, dem Great Pacific Garbage Patch, sollen etwa drei Millionen Tonnen Plastik mit der Strömung zwischen Amerika und Asien treiben. Oft werden die Abfälle illegal von Schiffen entsorgt oder sie werden vom Land in die See geweht.
Ein sorgloser Umgang mit für Recycling vorgesehenen Kunststoffpellets an den Verladestationen der Häfen vermüllt die Meere genauso wie Kunststoffpartikel, die auf Straßen von Reifen oder beim Waschen von Outdoor-Jacken abgerieben werden. Obwohl die genauen Zahlen über den Grad der Vermüllung schwer zu ermitteln sind, weil die Forscher jeweils mit unterschiedlichen Methoden arbeiten, ist eines gewiss: Der marine Müll ist gefährlich. Je winziger die Partikel, die Sonne, Wind und Wasser zermahlen, desto gefährlicher wird er. Wissenschaftler filtern aus dem Meereswasser Partikel mit einem Durchmesser von einem Mikrometer, also einem Tausendstel Millimeter. Vögel, Fische und andere Meereslebewesen nehmen die Teilchen auf und verhungern mit vollem Bauch (forum 4/2013 berichtete mit Bildern). Der Meeresbiologe Lars Gutow vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung vergleicht die Plastikteilchen mit
dem Kohlendioxid, das durch die Verbrennung fossiler Energieträger in die Atmosphäre gelangt: Einmal emittiert, lässt es sich nicht wieder einfangen. Die Plastikteilchen schwimmen im Meer und dort werden sie für Jahrhunderte bleiben. Die Polymere der verschiedenen Kunststoffe sind ausgesprochen stabil. Sie halten viel länger als die Produkte, die aus ihnen hergestellt werden, und hinterlassen ihre Spuren somit weit über ihren Lebenszyklus hinaus.
Allem Gerede von hohen Verwertungsquoten und die Mutation vom Müll zum Sekundärrohstoff in Deutschland zum Trotz: Die heute üblichen Kunststoffe lassen sich offensichtlich nicht in sinnvolle Kreisläufe führen. Um etwa Plastik recyceln zu können, ist teure Technik und teils viel Energie nötig. Auch die kompostierbaren Kunststoffe, ob auf Basis von Erdöl oder Pflanzen, brauchen spezielle Anlagen, um zu verrotten. Oft enthalten sie giftige Bestandteile wie Flammschutzmittel, Weichmacher oder Biozide, die ihre Nutzung als Sekundärrohstoff erschweren oder unmöglich machen. Genau wie bei den Elektronikgeräten sorgt die Komposition beispielsweise von Verpackungen aus verschiedenen, teils beschichteten Materialien dafür, dass ihre Verbrennung als sinnvollste Lösung erscheint. Ob die neue Verpackungsverordnung wenigstens in diesem Stoffstrom Abhilfe schafft, ist fraglich.
Unser Abfallproblem werden wir erst dann in den Griff bekommen, wenn sich der Regulierungswille der Regierungen und der ökologische Eifer der Konsumenten nicht mehr auf das Ende der Wertschöpfungskette richten – sondern auf ihren Beginn. Anfang November hielten zwei große Unternehmen der Recyclingbranche in Berlin eine denkwürdige Pressekonferenz ab. Sie riefen quasi um Hilfe, weil die produzierende Industrie sich immer neue, immer irrer komponierte Materialien ausdenke – und es der Recyclingbranche überlasse, in Anlagen und Technik zu investieren, sie wieder auseinanderzudividieren oder irgendwie sinnvoll zu verwerten. Sie forderten, den Verbrauchern deutliche, plakative Hinweise auf Produkten zur Verfügung zu stellen, damit sie deren Recyclingfähigkeit sofort erkennen könnten. Allerdings ist das auch nur der zweitbeste Weg. Der beste wäre so einfach, und doch so schwierig, wenn die Konsumenten generell weniger kauften. Denn Abfall entsteht ja nicht, wenn wir ein Handy, einen Pullover oder eine Safttüte wegschmeißen. Sondern wenn wir sie herstellen.
Heike Holdinghausen ist Redakteurin bei der taz in Berlin und schreibt in der Redaktion Wirtschaft und Umwelt vor allem zu Rohstoffthemen. Im Frühjahr erscheint von ihr im Frankfurter Westendverlag „Deutschland. Abstieg eines Umweltmeisters. Unsere dunkle Öko-Bilanz".
In der Reihe „Stoffgeschichten" verfasste sie zusammen mit Luitgard Marschall den Band „Seltene Erden. Umkämpfte Rohstoffe des Hightech-Zeitalters".
Umwelt | Ressourcen, 01.12.2018
Dieser Artikel ist in forum Nachhaltig Wirtschaften 04/2018 - Frauen bewegen die Welt erschienen.

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
30
APR
2025
APR
2025
Franz Alt: Die Solare Weltrevolution - Aufbruch in eine neue Menschheitsepoche
In der Reihe "Mein Klima… in München"
80331 München und online
In der Reihe "Mein Klima… in München"
80331 München und online
07
MAI
2025
MAI
2025
MakerCamp Genossenschaften 2025
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
14
MAI
2025
MAI
2025
Klimaschutz im peruanischen Regenwald
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
29
JUN
2025
JUN
2025
Constellations Week 2025 in Südtirol
Inspiration, Klarheit und Empowerment
I-39010 Tisens-Prissian, Südtirol
Inspiration, Klarheit und Empowerment
I-39010 Tisens-Prissian, Südtirol
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Digitalisierung
Christoph Quarch empfiehlt allen seriösen Kräften den Rückzug von X