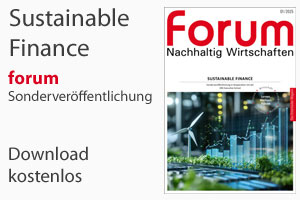Das Gemeinschaftsgeld
Radikale Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen
Die COVID-19-Krise hat scharf akzentuiert, wie zentral die staatliche Daseinsvorsorge für moderne Volkswirtschaften ist. Es wird deutlich, welche Folgen unvollständige soziale Netze haben: COVID-19 trifft etwa in den USA die afroamerikanische Bevölkerung am härtesten und birgt damit die Gefahr großer sozialer Spannungen. Gemeinschaftsgeld könnte hier Abhilfe schaffen.
 © pixabay, moritz320
© pixabay, moritz320 Daher gilt es, aus der Krise Schlüsse zu ziehen, was die Neugestaltung der staatlichen Daseinsvorsorge betrifft. Wir meinen, dass die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens attraktiver wird denn je: Stellen wir uns vor, es gäbe in der jetzigen Krise diese Institution, dann wären die Härten für viele abgefedert, die völlig unerwartet vom Verlust ihres Einkommens betroffen sind, und es gäbe Leitplanken für Verteilungseffekte. Die Idee ist nach wie vor umstritten, weil sich immer die Frage der Finanzierung stellt, doch es gibt eine radikale Alternative: das Gemeinschaftsgeld. Es erweitert und potenziert die Idee, dass die Marktwirtschaft durch eine umfassende Institutionalisierung der Solidargemeinschaft ergänzt werden muss, und zwar jenseits einer rein staatlichen Bereitstellung von Leistungen. Das erklärt den Namen „Gemeinschaftsgeld": Es geht um die Einrichtung eines eigenständigen Finanzkreislaufs, der das Prinzip der Gemeinschaft manifestiert, und der alle Formen der direkten Einkommenstransfers aus dem Staatshaushalt ersetzt.
Einfach – genial?
Die Idee ist simpel: Alle Vorschläge zum Grundeinkommen setzen voraus, dass dieses auch tatsächlich ausgezahlt wird, und sie vernachlässigen die Frage, welche komplementären Reformen des Steuersystems es geben muss, damit es auch nachhaltig finanzierbar ist. Das Gemeinschaftsgeld dagegen verknüpft eine radikale Reform des Systems der sozialen Sicherung mit einer ebenso radikalen Reform des Steuersystems, die in Grundzügen so funktioniert: Der Staat emittiert ein besonderes Wertpapier – „Gemeinschaftsgeld" genannt –, das nominal dem Geld gleichgesetzt ist und bedingungslos und jederzeit 1:1 in Euro umgetauscht werden kann. Jede BürgerIn hat mit der Volljährigkeit, gegebenenfalls schon vorher, das Recht, monatlich Gemeinschaftsgeld-Scheine im Umfang von zum Beispiel 1.000 Euro zu erhalten, lebenslang. Im Todesfall werden alle dann vorhandenen Scheine auf dem Konto der BürgerIn auf die Erben in Form von Freibeträgen der Erbschaftssteuer übertragen; sofern sie über den Wert des Erbes hinausgehen, werden sie annulliert, ähnlich wie heute die Ansprüche an die staatliche Rente nicht auf Nachkommen vererbt werden können. Das Gemeinschaftsgeld, das weder gepfändet noch abgetreten werden kann, ersetzt alle anderen Sozialleistungen, vor allem das Arbeitslosengeld und die staatliche Rente. Das Gemeinschaftsgeld selbst kann nicht als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Das heißt, es ist im Moment der Emission nicht budgetwirksam, sondern erst beim Umtausch. Das unterscheidet es wesentlich vom Grundeinkommen.
Spare – dann hast du in der Not
Warum sollten die BürgerInnen diesen Geldregen nicht gleich umtauschen? Dafür gibt es einmal Vorsorgegründe, die sich jeder Einzelne überlegen sollte, und zweitens Gründe, die sich aus der Verknüpfung von Finanzierung und steuerlicher Gestaltung herleiten.
Die Vorsorgegründe: Das Gemeinschaftsgeld kann angespart werden, unverzinst, aber mit der Inflationsrate indexiert, anders als das gesetzliche Zahlungsmittel. Es bestehen deshalb Anreize für alle Einkommensbezieher, es für schlechte Zeiten aufzubewahren, also auf den laufenden Umtausch zu verzichten, denn im Falle von Arbeitslosigkeit gibt es keinerlei Lohnfortzahlung oder anderen Lohnersatz. Wer arbeitslos wird, erhält zwar, wie jeder Mensch, sein laufendes Gemeinschaftsgeld, aber nicht mehr. Man ist also gut beraten, in der Zeit der Beschäftigung auf den Umtausch des Gemeinschaftsgeldes zu verzichten, um bei potentieller Arbeitslosigkeit den Lebensstandard zu halten. Der zweite Vorsorgegrund ergibt sich daraus, dass über das monatlich laufende Gemeinschaftsgeld hinaus keinerlei staatliche Rente gezahlt wird. Man kann also Gemeinschaftsgeld ansparen, das dann später, nach Renteneintritt umgetauscht wird, um die weiterhin fließenden monatlichen Zahlungen zu ergänzen. Man beachte, dass wir hier nur von der staatlichen Rente sprechen, nicht von privater Vorsorge, die natürlich komplementär immer möglich ist.
Von oben nach unten
Die Verknüpfung der Finanzierung des Gemeinschaftsgeldes mit einer Steuerreform ist die zentrale zweite Innovation unseres Vorschlages: Das Grundeinkommen löst weder die Herausforderung der Ungleichheit der Vermögensverteilung unserer Gesellschaften noch wird eine befriedigende Antwort zur Finanzierung des Grundeinkommens gegeben. Wir hingegen kombinieren das Gemeinschaftsgeld mit Freibeträgen auf die Erbschaftssteuer, gegebenenfalls – je nach finanzwissenschaftlicher Durchrechnung unseres Vorschlags – auch auf die Einkommenssteuer. Der Erbschaftssteuertarif wird für alle Erbschaften auf 100 Prozent erhöht, Freibeträge, auch für direkte Nachkommen, werden nicht unmittelbar gewährt. Freibeträge können aber durch Verzicht auf den Umtausch des Gemeinschaftsgeldes angesammelt werden, mindestens zum Nominalwert der Scheine, aber gegebenenfalls auch zu einem Vielfachen des Nominalwertes, um so einen Anreiz für diese Nutzung zu installieren. Die Finanzierungskonstellationen beeinflussen hier die konkrete Ausgestaltung. Wer also auf die Einlösung verzichtet, kann sein Vermögen im entsprechenden Umfang an die nächste Generation weitergeben, während das Gemeinschaftsgeld, das nicht so verwendet wird, verfällt.
Dazu greift eine weitere institutionelle Innovation: Das Gemeinschaftsgeld kann auf einer eigenen Börsenplattform gehandelt werden. Das bedeutet, wer ein großes Vermögen potentiell von der Erbschaftssteuer entlasten will, kann Gemeinschaftsgeld und die damit verknüpften Freibeträge dort kaufen. Das bedeutet natürlich, dass andere ihre Ansprüche aufgeben – aber sie können nie unter die monatliche Grundsicherung fallen, weil diese ja fortlaufend ausgezahlt wird. Das interessante an dieser Lösung ist, dass ohne Zweifel größere Beträge des Gemeinschaftsgeldes nicht direkt beim Staat eingelöst werden, sondern zunächst über die Börse gehandelt werden, und dann nur über die Erbschaftssteuerbefreiung budgetrelevant werden, oder – wie gewünscht – erst in rezessiven Phasen, wie etwa aktuell, relevant werden. An der Börse stellt sich ein Marktpreis ein, der vermutlich vom Satz 1:1 nach oben abweichen wird, die Finanzierung würde so automatisch einen Umverteilungsprozess „von oben nach unten" erzeugen.
Solidarisch
Unser Modell des Gemeinschaftsgeldes greift noch weiter: Es verbrieft den ökonomischen Wert der Solidargemeinschaft. Gemeinschaftsgeld wird nicht nur jedem Menschen monatlich zugeteilt, es kann auch erworben werden, indem man sich im Nicht-Marktsektor engagiert: Die Kindererziehung und Pflege zu Hause, das Engagement in NGOs, das Ehrenamt im Sportverein. Es gibt eine politisch festgelegte Liste von Sätzen, die für solche Leistungen ausgezahlt werden (Pflegesätzen vergleichbar). Stellen wir uns der Einfachheit halber vor, dass ein Ehepaar entscheidet, ein Partner übernehme die Haushaltsführung und Kinderbetreuung, und dafür gebe es zusätzlich einen Satz von 500 Euro monatlich pro Kind. Dann wird das Gemeinschaftsgeld entsprechend aufgestockt. Jede:r Bürger:in kann entsprechend entscheiden, sich verstärkt im Gemeinschaftsbereich zu engagieren und Gemeinschaftsgeld zu erlangen.
Die Verbindung zwischen Marktwirtschaft und Solidargemeinschaft wird also nicht mehr direkt durch staatliche Sicherung hergestellt, sondern durch einen Finanzierungskreislauf, der wesentlich am Vermögen der Privaten ansetzt, und nicht am Einkommen. Daher wird auch direkt auf die Vermögensverteilung Einfluss genommen, in der langen Frist. Der Staat wird in der florierenden Konjunktur weniger belastet, weil es nicht zu Auszahlungen kommen wird. In Krisenzeiten wird sofort Abhilfe geschaffen. Und ein letzter, bedeutender Vorteil: Die Bürger:innen entscheiden selbstbestimmt, wie sie
das Gemeinschaftsgeld einsetzen. Die Sozialpolitik ist nicht mehr in den Händen des Leviathans.
Hinweis: Eine ausführliche Vorstellung des Konzeptes finden Sie in einem Buch unserer Autoren „Manifest der Marktwirtschaft", das voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen wird.
Stephan Bannas hat BWL, VWL und Katholische Theologie studiert und in VWL-Theorie an der Uni Köln promoviert. Er war politischer Berater auf europäischer Ebene und für Hightech-Fragen. Seine Unternehmensgruppe beschäftigt sich mit der Aus- und Weiterbildung in der Steuer- und Rechtsberaterbranche. Er ist Autor zahlreicher Fachbücher, veröffentlicht aber auch zu sozialphilosophischen und gesellschaftskritischen Themen.
Carsten Herrmann-Pillath ist Professor und Permanent Fellow am Max Weber Kolleg der Universität Erfurt und hat VWL und Sinologie studiert. Forschungsgebiete: Wirtschaftsordnungen, Ökologische Ökonomik, Wirtschaftsphilosophie. Professuren in Duisburg, Witten/Herdecke und Frankfurt School of Finance and Management, sowie zahlreiche internationale Gastprofessuren. Sein wissenschaftliches Werk umfasst 16 Bücher und mehr als 400 wissenschaftliche Artikel, davon viele in internationalen Fachzeitschriften.
Lifestyle | Geld & Investment, 10.06.2020
Dieser Artikel ist in forum 02/2020 - die Corona-Sonderausgabe - Einfach zum Nachdenken... und Handeln erschienen.

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
14
MAI
2025
MAI
2025
Klimaschutz im peruanischen Regenwald
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
19
MAI
2025
MAI
2025
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Politik
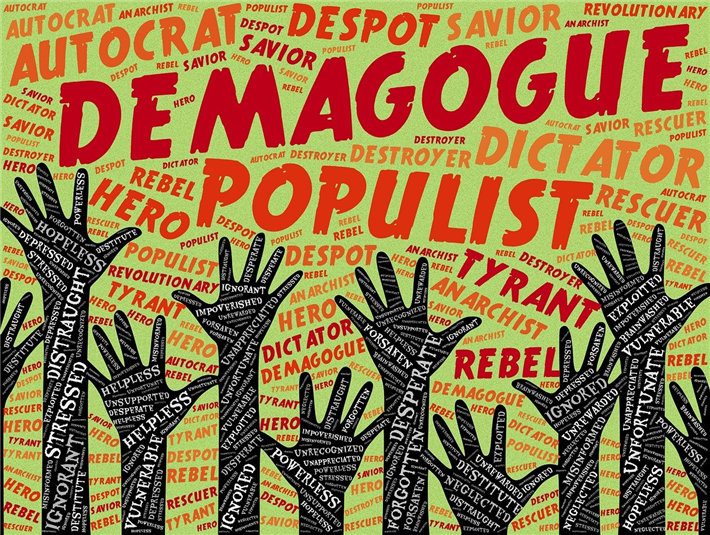 "Wir brauchen Menschen, die vom Geist Europas beseelt sind und ihn allen Widrigkeiten zum Trotz zur Geltung bringen wollen."
"Wir brauchen Menschen, die vom Geist Europas beseelt sind und ihn allen Widrigkeiten zum Trotz zur Geltung bringen wollen."Christoph Quarch überlegt, was wir den tyrannischen Ambitionen des globalen Trumpismus und des hiesigen Rechtspopulismus entgegensetzen können