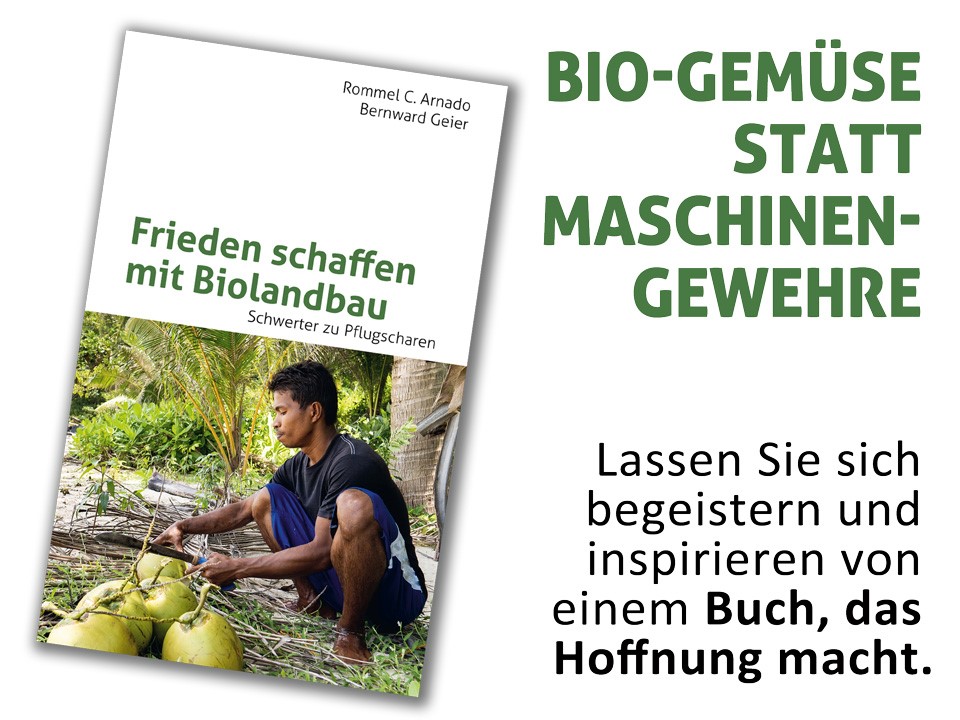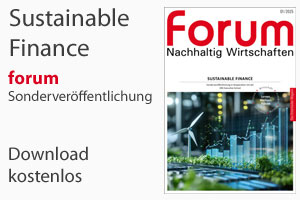Lasst uns Sterben lernen!
Loslassen für NICHTS
Was tun wir nicht alles, um das menschliche Leben zu verlängern? Das große Versprechen der modernen Medizin: Werdet älter als alle Generationen zuvor! Das Silicon Valley forscht zur Unsterblichkeit, quasi als Nachfolgeorganisation der sowjetischen Kosmisten, die die Verstorbenen wieder auferstehen lassen und gemeinsam mit ihnen das Weltall besiedeln wollten. Auch das Sterben von Firmen, Branchen und veralteten Denkweisen macht uns Probleme. Zeit, über das Sterben nachzudenken.
 © geralt, pixabay
© geralt, pixabayAuch auf institutioneller Ebene fällt es uns nicht leicht, Abschied zu nehmen. Wie geht es mit dem Loslassen, Sterbenlassen von Firmen, ganzen Industriebereichen? Systemrelevant? Arbeitsplätze, die auf dem Spiel stehen? Unser eigener Job, dessen Sinnhaftigkeit wir schon lange hinterfragen? Häufig werden wirtschaftliche Gründe angeführt, warum man z.B. die Banken in der Finanzkrise 2008 nicht hat insolvent gehen lassen können, oder, im Hinblick auf die Klima-Herausforderung, die Kohleindustrie oder die industrielle Landwirtschaft.
Wer wird gerettet und warum?
Im Zuge von Corona wird es noch ein Vielfaches an Hilfsgeldern brauchen, um die eine Industrie zu stützen und dagegen andere Firmen, ja ganze Branchen womöglich insolvent gehen zu lassen. Die häufig genannte Triage im medizinischen Kontext greift dann auch hier: Wer bekommt die Gelder (das Beatmungsgerät) und wer nichts, oder maximal Morphium in Form einer geordneten Insolvenz, um die Schmerzen zu lindern? Bislang gibt es zu diesen Fragen keinerlei öffentlichen Diskurs – während die PR-Maschinen der Wirtschaftsverbände und Großkonzerne im Wettkampf um die Hilfsgelder bereits auf vollen Touren laufen.
Corona zeigt mit seinen individuellen Schicksalen, Todesfällen und den betriebswirtschaftlichen Insolvenzen, dass wir um das Sterben als Menschen und auch als Organisationen und Institutionen nicht herumkommen – nicht nur im Angesicht der Krise, sondern im Angesicht des Lebens. Die Frage muss deshalb lauten: Wie wollen wir sterben? Wie und wann? Wer kann oder soll darüber entscheiden? Dabei muss die Sterbehilfe für bestimmte Industriezweige ja nicht zwangsläufig den finanziellen Tod der Beschäftigten bedeuten. In einigen Fällen allerdings womöglich einen sozialen Tod durch zeitweise Arbeitslosigkeit oder sozialen Abstieg, durch fehlende berufliche Anerkennung.
Wieso fällt es uns so schwer, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen? Woher kommt diese Verdrängung?
Warum können wir nicht sterben?
Das Sterben gehört zum Leben. Sei es, um Nährstoffe für andere Lebewesen zur Verfügung zu stellen oder um neuen Wirtschaftsweisen Platz zu machen. Um Raum zu schaffen. Für neues Denken und Handeln. Für andere Lebens- und Daseinsformen. Doch genau damit tun wir uns schwer. Auch im globalen Maßstab können und wollen wir uns nicht zurückziehen: Wir wollen nicht stagnieren oder gar schrumpfen. Nein, wir weiten unsere wirtschaftlichen Aktivitäten immer weiter aus, fällen Regenwälder, pflanzen riesige Monokulturen, verpesten die Umwelt und verursachen damit das sechste große Artensterben in der planetaren Geschichte. Mittlerweile wissen wir es. Die Informationen liegen vor. Aber auch dieses Sterben lassen wir nicht an uns heran.
Damit wir Menschen etwas besser und im Idealfall sogar ein paar Jahre länger leben können als vorangegangene Generationen, weiten wir einen Lebenswandel aus, der andere Lebewesen und Kulturen das Leben kostet. Zu Millionen. Unsere eigene Leugnung des Todes, unsere eigene Unfähigkeit, uns auf eine sinnvolle, wahrhaft ökologisch zivilisierte Art und Weise mit dem Altern und dem Sterben auseinanderzusetzen, sorgt dafür, dass wir andere für uns sterben lassen – auch um an ihre Ressourcen zu kommen. Wir opfern sie und wollen am Ende sogar diese Tode nicht sehen, wollen sie emotional nicht wahrhaben, obwohl wir faktisch um sie wissen. Die Preisfragen lauten: Warum oder wozu tun wir das? Wie würde eine ökologische Zivilisation mit diesen Themen umgehen? Wieviele mögliche Erklärungen könnte es geben – philosophische, psychologische, soziologische oder theologische Antworten? Vielleicht ist es aber auch unmöglich, eine Antwort zu finden, bevor wir nicht ernsthaft versucht haben, uns dem Tod zu nähern. Ihn wieder mehr in unser Leben zu lassen. Ihn zu erspüren. Können wir überhaupt Dinge denken, die wir entsinnlicht haben? Von denen wir keinen Geschmack haben (Wie schmeckt der Tod?), keinen Geruch (Wie riecht der Tod?), keine Töne (Wie klingt der Tod?), kein Gefühl durch Berührung (Wie fühlt sich ein toter Körper an?).
Loslassen für nichts
Ist es am Ende eher unsere Angst vor dem sinnlosen, entsinnlichten Sterben, als dass es volkswirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Hürden sind, die uns daran hindern, die liebgewonnenen Denk- und Sichtweisen, Wirtschaft oder Politik zu betreiben, loszulassen? Was würde geschehen, wenn wir unseren Fortschrittsglauben loslassen? Was würde geschehen, wenn wir eine wirkliche, ökologische Zivilisation anstreben würden? Was würde geschehen, wenn wir unseren Glauben an Geld und Technologie beerdigen und uns auf neue Sinnlichkeiten einlassen würden? Was bräuchte es, die Idee der Europäischen Union zu beerdigen für die Idee einer Weltgemeinschaft im Angesicht globaler, klimatischer Herausforderungen? Wie könnten wir die Idee von unendlichem (Bevölkerungs- und Wirtschafts-) Wachstum begraben, um über neue Formen des Wirtschaftens und Zusammenlebens offen und ehrlich miteinander reden zu können? Wie könnte ein vermeintlicher Verlust an sozialem Status durch freiwillig gewählte Bescheidenheit begleitet werden, die anderen Kulturen und Lebewesen mehr Raum zugesteht? Worin sollte unser Wohlstand eigentlich bestehen?
Vielleicht fühlt sich dieses Nichts lebendiger und schöner an als wir denken.
Vielleicht hat die eine oder der andere beim Lesen des letzten Absatzes gespürt, dass es zwischen dem Loslassen und dem Neuen eine Leere geben würde. Ein Nichts. Ein Nicht-Wissen. Eine Spannung. Und vielleicht ist das ja am Ende sogar die noch viel größere Herausforderung für uns alle, diese Spannung, diese Leere gemeinsam auszuhalten. Zu erleben. Das Aushalten einer Frage, auf die es immer mal wieder Antworten gab, bei denen wir aber von keiner wissen, ob sie stimmt. Die Frage, die da lautet: Was kommt eigentlich nach dem (sozialen) Tod? Vielleicht erst einmal nichts.
Martin A. Cielsielski arbeitete für deutsche und amerikanische Banken sowie Tech-Unternehmen. Er ist einer der Gründer von the school of nothing. Als head of nothing entwickelt er dort gemeinsam mit 12 anderen Lehrenden Formate, um endlich nichts zu erleben, Lassenskraft zu entwickeln und das schöne Loslassen zu lernen. Er lebt in Berlin.
Gesellschaft | Megatrends, 10.06.2020
Dieser Artikel ist in forum 02/2020 - die Corona-Sonderausgabe - Einfach zum Nachdenken... und Handeln erschienen.

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
07
MAI
2025
MAI
2025
MakerCamp Genossenschaften 2025
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
08
MAI
2025
MAI
2025
Die intelligente Transformation: ESG + KI = Zukunftssicherung
Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen
Webinar
Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen
Webinar
14
MAI
2025
MAI
2025
Klimaschutz im peruanischen Regenwald
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Sport & Freizeit, Reisen
 Helau, Alaf, Narri Narro!
Helau, Alaf, Narri Narro!Christoph Quarch freut sich über die spielerische Aussetzung der Ordnung während der Karnevalstage