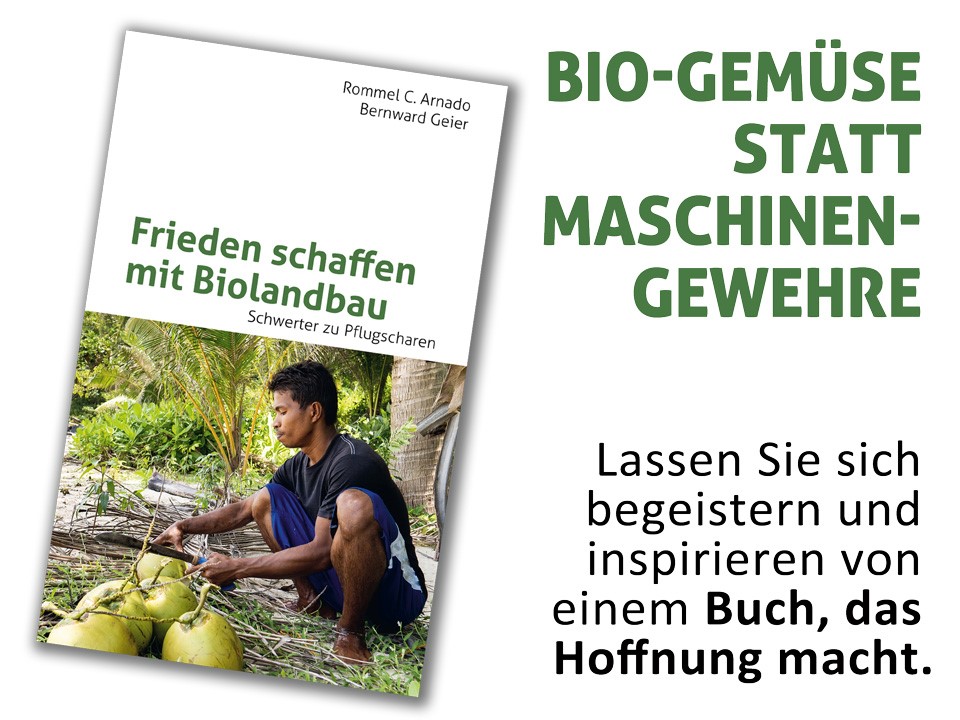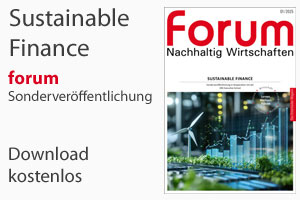Widersprüchliche Vorannahmen: Corona und die Freiheit
Der aktuelle Kommentar von Philipp von Becker
Die Einschnitte durch die Corona-Maßnahmen wurden von einem Großteil der Bevölkerung im Glauben an das Gute, an Solidarität und den Schutz des Lebens unterstützt. Doch tragischerweise beruht dieser Glaube auf irrigen Vorannahmen, Widersprüchen und einem ethischen Missverständnis.
Die breite Unterstützung der Corona-Politik innerhalb der Funktionseliten und die vorgebrachte ethische und rechtliche Legitimation der Grundrechtseinschränkungen basiert in erster Linie auf der Vorannahme, dass mit den Einschränkungen noch größere Einschränkungen und Schädigungen verhindert wurden. Doch dabei handelt es sich eben um eine Vorannahme, die alles andere als eindeutig und unstrittig ist. So lassen Vergleiche zwischen Ländern mit starken und weniger starken Einschränkungen keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen sogenannten „nicht-pharmazeutischen Interventionen" und dem Infektionsgeschehen erkennen. Während die Evidenz für eine signifikante Verhinderung von Schädigungen durch die Maßnahmen also mindestens strittig ist, ist die Evidenz für bereits eingetretene und noch kommende Schädigungen als Folge der Maßnahmen erdrückend. Denn wissenschaftlich unstrittig ist, dass Angst, Armut, Isolation, Unsicherheit und Stress das Risiko von Erkrankungen erhöhen und die Lebenserwartung reduzieren.
Das ethische Dilemma
 Die Corona-Maßnahmen müssen ethisch genau abgewogen werden, sagt Philipp von Becker. © Tumisu pixabay.comAnerkannt werden müsste deshalb, dass wir uns bezüglich Corona in einem ethischen Dilemma befanden und auch weiterhin befinden werden, falls Therapeutika keinen dauerhaften Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung bieten. Denn erstens kann in einer globalisierten Zivilisation ein sich offenbar derart effektiv über die Atemwege verbreitender Erreger nicht ausgerottet werden – weshalb „ZeroCovid" von Beginn an eine Fiktion war. Zweitens bedeutet dies, dass jeder früher oder später mit dem Virus in Kontakt kommen wird und die Vermeidung von Ansteckung und möglicher Erkrankung – Therapeutika ausgeklammert – nur zum Preis der Vermeidung von menschlichem Kontakt und totaler Überwachung also nur zum Preis von Gesundheit, Freiheit und Menschsein zu haben ist. Und drittens ist deshalb die Suggestion, es handle sich im Falle der Coronamaßnahmen um eine Abwägung zwischen Gesundheit und Freiheit – namentlich Art.2 Abs.1 GG (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) und Art.2 Abs.1 GG (freie Entfaltung der Persönlichkeit) – schlichtweg falsch. Denn durch die Lockdown-Politik wurde Angst, Armut, Stress, Hunger und Krankheit erzeugt und damit nicht nur in die freie Entfaltung der Persönlichkeit, sondern auch in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowie die Würde des Menschen eingegriffen.
Die Corona-Maßnahmen müssen ethisch genau abgewogen werden, sagt Philipp von Becker. © Tumisu pixabay.comAnerkannt werden müsste deshalb, dass wir uns bezüglich Corona in einem ethischen Dilemma befanden und auch weiterhin befinden werden, falls Therapeutika keinen dauerhaften Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung bieten. Denn erstens kann in einer globalisierten Zivilisation ein sich offenbar derart effektiv über die Atemwege verbreitender Erreger nicht ausgerottet werden – weshalb „ZeroCovid" von Beginn an eine Fiktion war. Zweitens bedeutet dies, dass jeder früher oder später mit dem Virus in Kontakt kommen wird und die Vermeidung von Ansteckung und möglicher Erkrankung – Therapeutika ausgeklammert – nur zum Preis der Vermeidung von menschlichem Kontakt und totaler Überwachung also nur zum Preis von Gesundheit, Freiheit und Menschsein zu haben ist. Und drittens ist deshalb die Suggestion, es handle sich im Falle der Coronamaßnahmen um eine Abwägung zwischen Gesundheit und Freiheit – namentlich Art.2 Abs.1 GG (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) und Art.2 Abs.1 GG (freie Entfaltung der Persönlichkeit) – schlichtweg falsch. Denn durch die Lockdown-Politik wurde Angst, Armut, Stress, Hunger und Krankheit erzeugt und damit nicht nur in die freie Entfaltung der Persönlichkeit, sondern auch in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowie die Würde des Menschen eingegriffen.
Politik verrechnet immer Leben
Und somit führt die von Unterstützern der Grundrechtseinschränkungen hochgehaltene deontologische Ethik, derzufolge man keine Menschenleben miteinander verrechnen darf, ebenfalls in die Irre. Denn indem die aus der Lockdown-Politik resultierenden, erst in fernerer Zukunft eintretenden vorzeitigen Tode niedriger gewichtet wurden als die Vermeidung von Infektionen von älteren Menschen und die damit möglicherweise erzielte Vermeidung in näherer Zukunft eintretender vorzeitiger Tode, wurden de facto Menschenleben miteinander verrechnet. Und auch wenn wir dies in der Theorie des kantischen Ideals nicht dürfen, tun wir dies in der Praxis des Lebens ständig: Politik ist nichts anderes als die kontinuierliche Verrechnung von Lebenschancen.
Das noch größere Leid verhindern
So werden etwa in der Praxis der gegenwärtigen europäischen Wirtschafts-, Steuer- und Handelspolitik die Lebenschancen junger und künftiger Generationen vielfach niedriger gewichtet als die Lebenschancen heutiger und älterer Menschen. Und damit nähern wir uns dem Kern des Arguments. Denn die Frage, die sich hier stellt und von einer kritischen Öffentlichkeit hätte gestellt werden müssen, lautet: Warum unternehmen wir bei durch Unterernährung, verunreinigtes Trinkwasser, Luftverschmutzung, Kriege oder die Folgen des Klimawandels erzeugten vorzeitigen Todesfällen nicht mindestens ebenso viel, um sie zu verhindern, obwohl die genannten und sonstigen Krankheits- und Todesursachen in der Summe weitaus mehr Leid, Kranke und Tote fordern – und ohne radikalen Wandel vor allem noch fordern werden – als Covid-19?
Uns auf das besinnen, was wir kontrollieren können
Würde diese Frage gestellt werden, würde die doppelte Unverhältnismäßigkeit der gegen Covid-19 getroffenen Maßnahmen noch frappierender zu Tage treten. Und diese wiegt umso schwerer, als dass es einen entscheidenden Unterschied gibt: Denn während akzeptiert werden müsste, dass es trotz aller moderner Weltaneignungs- und Kontrolltechniken nach wie vor Geschehnisse und Zusammenhänge gibt, über die wir nicht vollständig verfügen können, und es schlicht Krankheiten gibt, die wir (zumindest noch) nicht vollständig beseitigen können, befinden wir uns bei den genannten anderen Ursachen für Krankheit und Tod nicht in einem ethischen Dilemma. Vielmehr wäre es möglich, die Kranken und Toten infolge von Unterernährung, verunreinigtem Trinkwasser, Luftverschmutzung, Kriegen oder den Folgen des Klimawandels zu verhindern, ohne Grundrechte auszusetzen und Menschen zu schädigen. Im Gegenteil: Die Bekämpfung dieses Leids und Sterbens wäre erst eine Ermöglichung von Grundrechten, die wir mit unserem Handeln und Nichthandeln einschränken.
Die Entschleierung unseres Freiheitsbegriffs
 Philipp von Becker. © privatEndgültig als Fiktion dekonstruiert werden müsste in diesem Zusammenhang der vulgäre Freiheitsbegriff, der die letzten Jahrzehnte dominierenden („neoliberalen") Ideologie. Das eigentlich Erstaunliche an der politischen Reaktion auf Corona war, dass die polit-medialen Eliten die Fiktionalität dieses Freiheitsbegriffs indirekt eingestanden – diese Steilvorlage aber von der politischen Linken nicht genutzt wurde. Denn eingestanden wurde im Falle von Corona, dass die Bedingungen, Möglichkeiten und Folgen individuellen Handelns immer auch kollektive Bedingungen, Möglichkeiten und Folgen haben und wir alle intersubjektiv in einem großen Netz des Lebens miteinander verbunden sind und voneinander abhängen. In vielen anderen Fällen wurden und werden Einschränkungen individueller Freiheit zum Schutz der Freiheit anderer jedoch massiv bekämpft, geleugnet und verhindert. So war der Diskurs der letzten Jahrzehnte von Appellen nach „Eigenverantwortung" und der Negation sozialer Bedingungen und Folgen individuellen Handelns geprägt und wurde mittels dieses invertiert-pervertierten Freiheitsbegriffs die Illusion aufrechterhalten, es handle sich bei einem Flug nach Teneriffa, Kauf eines SUVs oder Verzehr eines Schnitzels um eine „freie" individuelle Entscheidung, die in keinerlei Bezug zu den Freiheitsmöglichkeiten und Rechten anderer Lebewesen stünde.
Philipp von Becker. © privatEndgültig als Fiktion dekonstruiert werden müsste in diesem Zusammenhang der vulgäre Freiheitsbegriff, der die letzten Jahrzehnte dominierenden („neoliberalen") Ideologie. Das eigentlich Erstaunliche an der politischen Reaktion auf Corona war, dass die polit-medialen Eliten die Fiktionalität dieses Freiheitsbegriffs indirekt eingestanden – diese Steilvorlage aber von der politischen Linken nicht genutzt wurde. Denn eingestanden wurde im Falle von Corona, dass die Bedingungen, Möglichkeiten und Folgen individuellen Handelns immer auch kollektive Bedingungen, Möglichkeiten und Folgen haben und wir alle intersubjektiv in einem großen Netz des Lebens miteinander verbunden sind und voneinander abhängen. In vielen anderen Fällen wurden und werden Einschränkungen individueller Freiheit zum Schutz der Freiheit anderer jedoch massiv bekämpft, geleugnet und verhindert. So war der Diskurs der letzten Jahrzehnte von Appellen nach „Eigenverantwortung" und der Negation sozialer Bedingungen und Folgen individuellen Handelns geprägt und wurde mittels dieses invertiert-pervertierten Freiheitsbegriffs die Illusion aufrechterhalten, es handle sich bei einem Flug nach Teneriffa, Kauf eines SUVs oder Verzehr eines Schnitzels um eine „freie" individuelle Entscheidung, die in keinerlei Bezug zu den Freiheitsmöglichkeiten und Rechten anderer Lebewesen stünde.
Wer Leben schützen will, muss anders wirtschaften
Die breite Unterstützung der Corona-Politik innerhalb der Funktionseliten und die vorgebrachte ethische und rechtliche Legitimation der Grundrechtseinschränkungen basiert in erster Linie auf der Vorannahme, dass mit den Einschränkungen noch größere Einschränkungen und Schädigungen verhindert wurden. Doch dabei handelt es sich eben um eine Vorannahme, die alles andere als eindeutig und unstrittig ist. So lassen Vergleiche zwischen Ländern mit starken und weniger starken Einschränkungen keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen sogenannten „nicht-pharmazeutischen Interventionen" und dem Infektionsgeschehen erkennen. Während die Evidenz für eine signifikante Verhinderung von Schädigungen durch die Maßnahmen also mindestens strittig ist, ist die Evidenz für bereits eingetretene und noch kommende Schädigungen als Folge der Maßnahmen erdrückend. Denn wissenschaftlich unstrittig ist, dass Angst, Armut, Isolation, Unsicherheit und Stress das Risiko von Erkrankungen erhöhen und die Lebenserwartung reduzieren.
Das ethische Dilemma
 Die Corona-Maßnahmen müssen ethisch genau abgewogen werden, sagt Philipp von Becker. © Tumisu pixabay.com
Die Corona-Maßnahmen müssen ethisch genau abgewogen werden, sagt Philipp von Becker. © Tumisu pixabay.comPolitik verrechnet immer Leben
Und somit führt die von Unterstützern der Grundrechtseinschränkungen hochgehaltene deontologische Ethik, derzufolge man keine Menschenleben miteinander verrechnen darf, ebenfalls in die Irre. Denn indem die aus der Lockdown-Politik resultierenden, erst in fernerer Zukunft eintretenden vorzeitigen Tode niedriger gewichtet wurden als die Vermeidung von Infektionen von älteren Menschen und die damit möglicherweise erzielte Vermeidung in näherer Zukunft eintretender vorzeitiger Tode, wurden de facto Menschenleben miteinander verrechnet. Und auch wenn wir dies in der Theorie des kantischen Ideals nicht dürfen, tun wir dies in der Praxis des Lebens ständig: Politik ist nichts anderes als die kontinuierliche Verrechnung von Lebenschancen.
Das noch größere Leid verhindern
So werden etwa in der Praxis der gegenwärtigen europäischen Wirtschafts-, Steuer- und Handelspolitik die Lebenschancen junger und künftiger Generationen vielfach niedriger gewichtet als die Lebenschancen heutiger und älterer Menschen. Und damit nähern wir uns dem Kern des Arguments. Denn die Frage, die sich hier stellt und von einer kritischen Öffentlichkeit hätte gestellt werden müssen, lautet: Warum unternehmen wir bei durch Unterernährung, verunreinigtes Trinkwasser, Luftverschmutzung, Kriege oder die Folgen des Klimawandels erzeugten vorzeitigen Todesfällen nicht mindestens ebenso viel, um sie zu verhindern, obwohl die genannten und sonstigen Krankheits- und Todesursachen in der Summe weitaus mehr Leid, Kranke und Tote fordern – und ohne radikalen Wandel vor allem noch fordern werden – als Covid-19?
Uns auf das besinnen, was wir kontrollieren können
Würde diese Frage gestellt werden, würde die doppelte Unverhältnismäßigkeit der gegen Covid-19 getroffenen Maßnahmen noch frappierender zu Tage treten. Und diese wiegt umso schwerer, als dass es einen entscheidenden Unterschied gibt: Denn während akzeptiert werden müsste, dass es trotz aller moderner Weltaneignungs- und Kontrolltechniken nach wie vor Geschehnisse und Zusammenhänge gibt, über die wir nicht vollständig verfügen können, und es schlicht Krankheiten gibt, die wir (zumindest noch) nicht vollständig beseitigen können, befinden wir uns bei den genannten anderen Ursachen für Krankheit und Tod nicht in einem ethischen Dilemma. Vielmehr wäre es möglich, die Kranken und Toten infolge von Unterernährung, verunreinigtem Trinkwasser, Luftverschmutzung, Kriegen oder den Folgen des Klimawandels zu verhindern, ohne Grundrechte auszusetzen und Menschen zu schädigen. Im Gegenteil: Die Bekämpfung dieses Leids und Sterbens wäre erst eine Ermöglichung von Grundrechten, die wir mit unserem Handeln und Nichthandeln einschränken.
Die Entschleierung unseres Freiheitsbegriffs
 Philipp von Becker. © privat
Philipp von Becker. © privatWer Leben schützen will, muss anders wirtschaften
Da dies nicht der Fall ist, müsste endlich zu einem Freiheitsverständnis gelangt werden, mit dem das Leben auf dem Planeten tatsächlich geachtet und geschützt wird. Hierfür müsste die Frage nach Eigentumsverhältnissen und öffentlichen Gütern in den Fokus rücken und es wäre eine Steuer- und Handelspolitik erforderlich, die Unternehmen etwa nicht nach ihrer monetären Bilanz, sondern ihrer Gemeinwohlbilanz bewertet – wie es das Konzept der Gemeinwohlökonomie vorsieht. Mit erneuerbaren Energien, einer Re-Regionalisierung von Wirtschaftskreisläufen, Prinzipien der Gemeinwohlökonomie und Kreislaufwirtschaft sowie neuen Formen von Eigentum und Mitbestimmung in Politik und Unternehmen könnte aus einer Politik, Wirtschaft und Kultur der Fremdbestimmung, Entfremdung und Verantwortungslosigkeit eine Politik, Wirtschaft und Kultur der Nähe, Autonomie und Verantwortung erwachsen. Und dies würde genau keine anti-liberale, anti-soziale Gesellschaft à la „Ökodiktatur" bedeuten, sondern die Aufhebung des anti-liberalen, anti-sozialen Status quo.
Philipp von Becker ist Autor, Filmemacher und Publizist. Im Passagen Verlag erschien von ihm "Der neue Glaube an die Unsterblichkeit. Transhumanismus, Biotechnik & digitaler Kapitalismus".
Dieser Beitrag ist eine bearbeitete und gekürzte Version eines Textes, der bei Telepolis erschienen ist.
Unter "Der aktuelle Kommentar" stellen wir die Meinung engagierter Zeitgenossen vor und möchten damit unserer Rolle als forum zur gewaltfreien Begegnung unterschiedlicher Meinungen gerecht werden. Die Kommentare spiegeln deshalb nicht zwingend die Meinung der Redaktion wider,
sondern laden ein zur Diskussion, Meinungsbildung und persönlichem
Engagement. Wenn auch Sie einen Kommentar einbringen oder erwidern
wollen, schreiben Sie an Alrun Vogt: a.vogt@forum-csr.net
Gesellschaft | Politik, 21.02.2022

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
14
MAI
2025
MAI
2025
Klimaschutz im peruanischen Regenwald
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
19
MAI
2025
MAI
2025
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Naturschutz
 Mika erzählt uns auch davon, dass diese Natur bedroht ist
Mika erzählt uns auch davon, dass diese Natur bedroht istChristoph Quarch empfindet beim Anblick des Eisbärenbabys im Karlsruher Zoo Demut