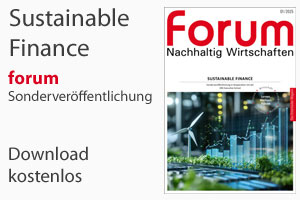Der Handel mit CO2
Wie Waldprojekte auf die Klimastrategie einzahlen
"Klimaneutrale" Produkte werden immer beliebter – und immer kontroverser. Viele Unternehmen setzen auf Kompensation ihrer Emissionen über Waldprojekte. Welche Risiken aber auch Chancen gehen damit einher, und was sollten Unternehmen über die aktuellen Entwicklungen wissen?
 Ein Aufforstungsprojekt in der Dominikanischen Republik: Dabei ist unbedingt die lokale Bevölkerung mit einzubeziehen. © OroVerde T. Klimpel
Ein Aufforstungsprojekt in der Dominikanischen Republik: Dabei ist unbedingt die lokale Bevölkerung mit einzubeziehen. © OroVerde T. KlimpelKonsument*innen wollen „klimaneutrale" Produkte kaufen. Unternehmen reduzieren dafür ihre Emissionen und kompensieren den Rest mit Emissionsgutschriften vom freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Die Projekte hinter den Gutschriften finden mehrheitlich im globalen Süden statt in den Bereichen Energie, Wald, Landwirtschaft, Wasserressourcenmanagement und Biodiversitätsschutz. Sie sind wichtig für den Klimaschutz – doch entsprechendes Know How bei der Auswahl und Kommunikation – vor allem bei Waldprojekten – ist geboten.
Wälder schützen, Profil gewinnen
Unternehmen können über Waldprojekte einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und sich gleichzeitig als klimabewusst am Markt positionieren. Eine transparente Kommunikation und sorgfältige Projektauswahl sind dabei ist dabei essentiell. Dies erhöht nicht nur die Glaubwürdigkeit, sondern reduziert auch rechtliche Risiken, denn Gutschriften aus zweifelhaften Waldprojekten stellen ein Risiko dar, wenn sie für Marketingaussagen über scheinbare Klimaneutralität genutzt werden. Dies ist unter anderem auf die Berichterstattung der vergangenen Jahre zurückzuführen, deren Enthüllungen das Vertrauen in Projektanbieter und Standardsetzer ins Wanken gebracht haben. Einzelne Aspekte von Waldkohlenstoffprojekten wurden zurecht kritisiert. Die EU hat allerdings grundsätzliche Regulierungen erlassen, die zukünftig klarere Vorgaben für Marketingaussagen im Klimaengagement setzen. Sie müssen zukünftig wissenschaftlich belegt und von einer Prüfstelle genehmigt sein. Ab 2026 darf der Begriff „klimaneutral" überhaupt nicht mehr in Bezug zu Kompensationsmaßnahmen verwendet werden.
Dennoch sollten sich Unternehmen durch Finanzierungsbeiträge für den Klimaschutz einsetzen und können dies dies als Teil ihrer Klimaschutzstrategie kommunizieren. Sie können dazu als „Contribution Claim" einen internen CO2-Preis auf ihre nicht vermeidbaren Emissionen festlegen und Klimaschutzprojekte in derselben Höhe fördern. Bei der finanziellen Unterstützung von Waldprojekten sollten Unternehmen auf nachfolgende Kriterien achten.
Die Erstellung und Berechnung von CO2-Gutschriften
In Waldschutzprojekten werden als Berechnungsgrundlage meist vergleichbare Waldgebiete genutzt. Die Abschätzung des Risikos für Entwaldung basiert auf Annahmen, Durchschnitts- oder Vergleichswerten, die zu ungenau berechneten Ergebnissen für das CO2-Vermeidungspotential führen. So wurde bei einigen Waldschutzprojekten nachgewiesen, dass die vermuteten Entwaldungsraten deutlich überschätzt und damit zu viele Emissionsgutschriften auf den Markt gebracht wurden. Gleichzeitig werden die Methoden zur Berechnung der CO2-Speicherleistung stetig verbessert, um bestehende Schwächen und Regelungslücken zu reduzieren. Moderne Technologien wie Satellitenüberwachung und Drohnen ermöglichen eine genauere Überwachung und Bewertung der Projekte. Viele Initiativen bieten Transparenz durch die Veröffentlichung ihrer Daten und Methoden, um das Vertrauen in den Kohlenstoffmarkt zu stärken.
In Waldwiederaufbauprojekten ist die Berechnung der CO2-Speicherleistung des zukünftigen Waldes von Variablen abhängig, die schwer abschätzbar sind. Daher empfiehlt es sich, erst nach der Projektumsetzung Gutschriften für die tatsächlich geleistete CO2-Speicherung zu generieren. Um die Finanzierungslücke der Projekte zu umgehen, könnten Unternehmen bereits vor der Umsetzung investieren und nach Projektende Gutschriften ausgeschüttet bekommen. Diese Investitionen tragen zur langfristigen Schaffung neuer Wälder bei, die nicht nur CO2 speichern, sondern auch Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten schaffen.
Zusätzlichkeit der Maßnahmen
Die Schaffung von Emissionsgutschriften ist nur dann sinnvoll und seriös, wenn Projekte tatsächlich zusätzlich sind, also ohne den Verkauf der Gutschriften nicht finanziert werden könnten und über gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen hinausgehen. Käufer*innen können dies durch die Verifizierung nach Standards wie dem Gold Standard in Deutschland oder weltweit durch den Verified Carbon Standard (VCS) oder Plan Vivo sicherstellen.
Die sozialen Aspekte bei Waldprojekten
Wird die lokale Bevölkerung in und um das Projektgelände nicht in die Planung und -implementierung einbezogen, drohen Landnutzungskonflikte. Mangelnde Aufklärung und Einbindung können zur Verlagerung der Entwaldung führen. Eine frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung der lokalen Bevölkerung ist entscheidend, damit Projekte positive soziale Auswirkungen haben, wie das Schaffen von Arbeitsplätzen und die Förderung der lokalen Wirtschaft.
Es gibt verschiedene Standards, die einen Schwerpunkt auf soziale Aspekte legen und in Kombination mit anderen Standards die Qualität der Projekte erhöhen. So ist eine Voraussetzung für die Zertifizierung nach dem Plan Vivo Standard, dass die Projektentwicklung in Kooperation mit lokalen Gemeinden erfolgt. Der Fairtrade Climate Standard (FCS) ergänzt zertifizierte Projekte und bietet die Besonderheit, dass die Emissionsgutschriften häufig von Kleinbäuer*innen oder ländlichen Gemeinden produziert werden. Die Emissionsgutschriften unterliegen zudem einem stabilen Mindestpreis, um eine nachhaltige Finanzierung der Projekte zu fördern. Unternehmen sollten daher die entsprechenden Maßnahmen in Projektbeschreibungen und Standardanforderungen berücksichtigen.
Dauerhafte CO2-Speicherung als Kernelement
 © OroVerde L. Krings ©
© OroVerde L. Krings ©Für die Überprüfung der CO2-Speicherung ist ein langfristiges Monitoring der Projektflächen entscheidend. Die meisten in Deutschland auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt angebotenen Projekte haben eine Laufzeit von circa 30 Jahren. Es wäre jedoch ein Monitoring über mindestens 100 Jahre sinnvoll, da Emissionen in der Atmosphäre weitaus länger als 30 Jahre bestehen. Beim Gutschriftenkauf sollten daher Monitoringdauer und Überprüfungsmethoden des Projektes beachtet werden.
Luise Sophie König ist Umweltökonomin, arbeitet für OroVerde und beschäftigt sich mit Waldprojekten auf dem globalen Kohlenstoffmarkt und nachhaltigen Finanzlösungen für biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft in den Tropen.
Andrea Reuter ist Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der Analyse von Finanzinstrumenten und Biodiversitätskriterien.
Lea Strub arbeitet zu den Themen Sustainable Finance und nachhaltige Lieferketten. Beide sind Projektmanagerinnen beim Gobal Nature Fund im Bereich Unternehmen und Biodiversität.
Umwelt | Klima, 16.11.2024
Dieser Artikel ist in forum 01/2025 ist erschienen - Pioniere der Hoffnung erschienen.

Save the Ocean
forum 02/2025 ist erschienen
- Regenerativ
- Coworkation
- Klimadiesel
- Kreislaufwirtschaft
Kaufen...
Abonnieren...
07
MAI
2025
MAI
2025
MakerCamp Genossenschaften 2025
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft
65189 Wiesbaden
08
MAI
2025
MAI
2025
Die intelligente Transformation: ESG + KI = Zukunftssicherung
Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen
Webinar
Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen
Webinar
14
MAI
2025
MAI
2025
Klimaschutz im peruanischen Regenwald
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven
80802 München, Seidlvilla
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Politik
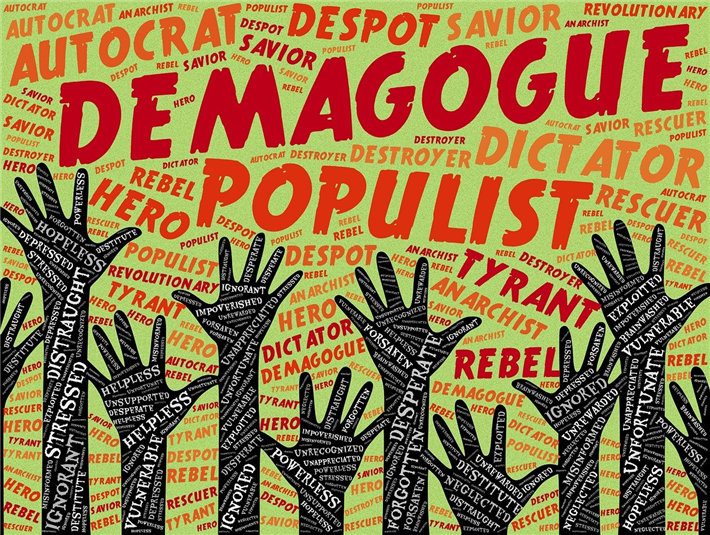 "Wir brauchen Menschen, die vom Geist Europas beseelt sind und ihn allen Widrigkeiten zum Trotz zur Geltung bringen wollen."
"Wir brauchen Menschen, die vom Geist Europas beseelt sind und ihn allen Widrigkeiten zum Trotz zur Geltung bringen wollen."Christoph Quarch überlegt, was wir den tyrannischen Ambitionen des globalen Trumpismus und des hiesigen Rechtspopulismus entgegensetzen können
Jetzt auf forum:
Dialog und Kooperation – Sie sind gefragt!
Gesundheits- und Sozialwirtschaft muss auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützt werden
„Ökobilanz-Rechner“ der DEUTSCHEN ROCKWOOL
Porsche investiert entschlossen in die Zukunft
ChangeNOW 2025: Ein Wendepunkt für die Wirtschaft der Zukunft